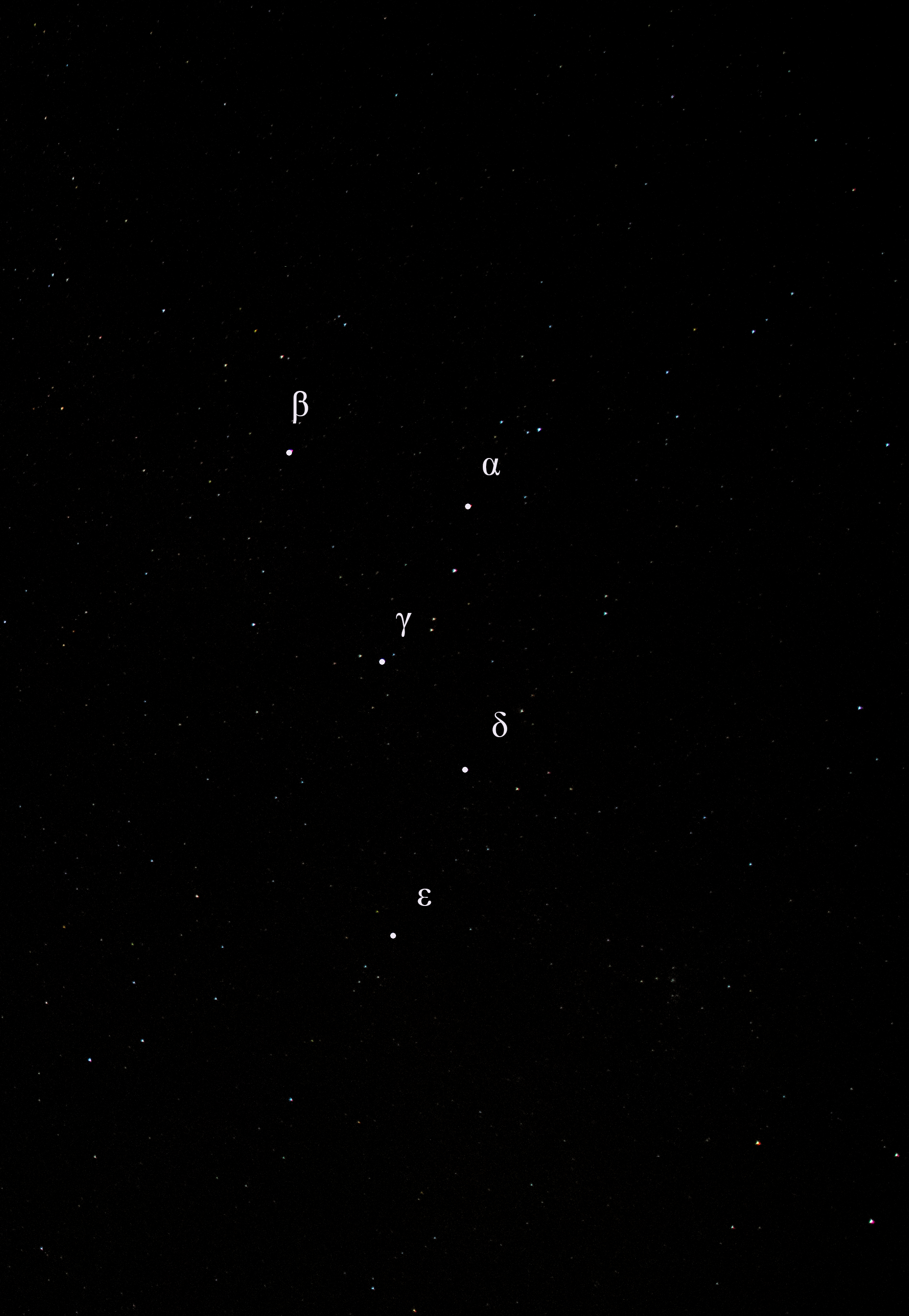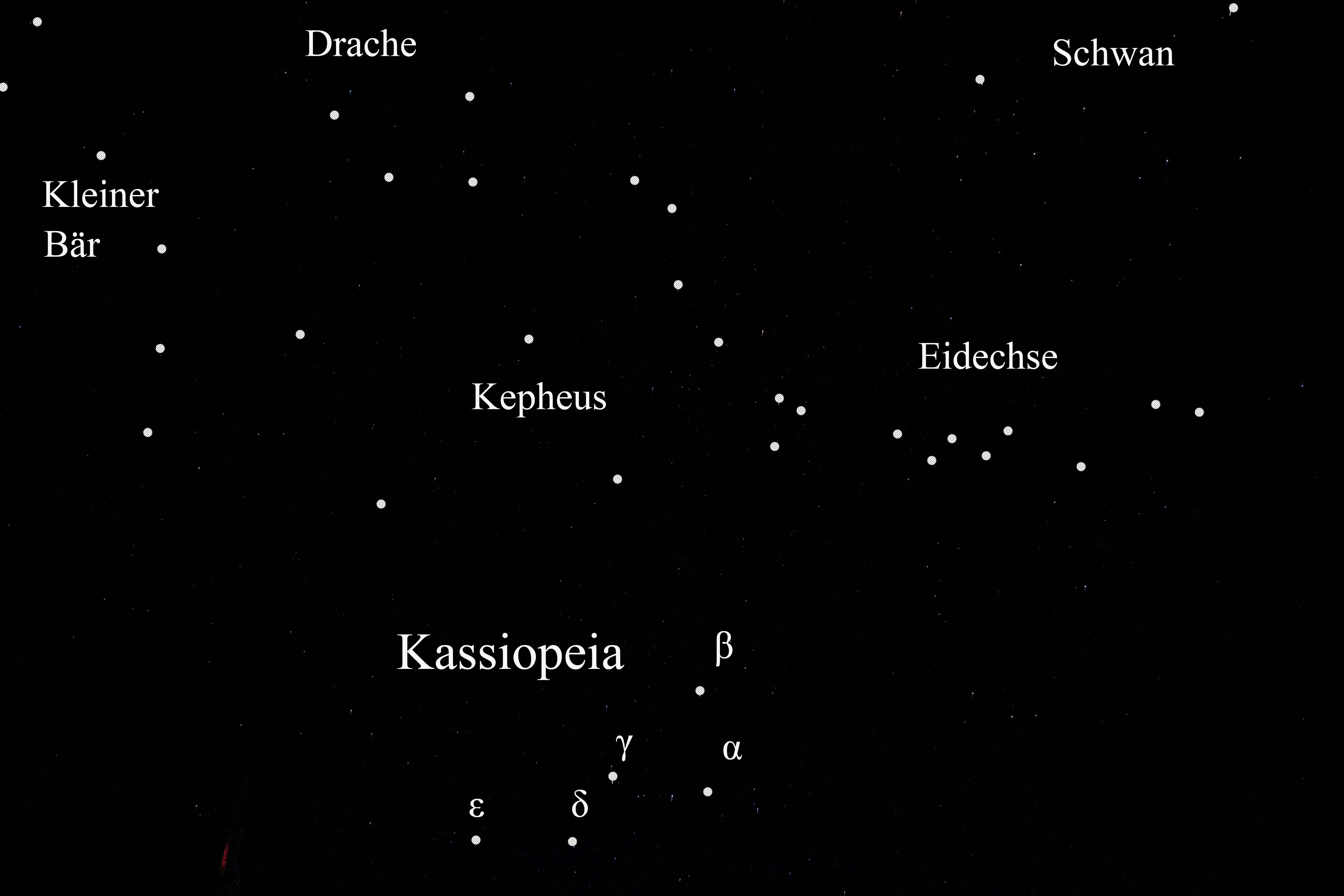1. Caph (β – Beta Cassiopeiae, 11 Cassiopeiae, HD 432)
Caph ist ein blau-weiß leuchtender Riesenstern der Spektralklasse F2III in einer Entfernung von 54,8 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + /- 0,32 Lichtjahren.
Spektralklassen werden dazu verwendet, um einen Stern in einer bestimmten Gruppe zusammenzufassen, wobei in der Bezeichnung auch schon eine relativ genaue Aussage zu den Eigenschaften des Sterns getroffen wird. Denn es werden weitere Unterteilungen vorgenommen.
Die Einteilung der Spektralklassen beruht bis heute auf der Basis, die im 19. Jahrhundert gelegt wurde. Zwischenzeitlich wurde das System immer mehr verfeinert, so dass anhand der Spektralklasse schon eine grobe Zusammenfassung über einen Stern möglich ist.
Caph wird laut der SIMBAD-Datenbank in der Spektralklasse F (lateinischer Buchstabe) verortet. In früheren Zeiten wurde angenommen, dass Sterne der Spektralklasse F in der Mitte ihrer Entwicklung stehen.
Die Sterne der Spektralklasse F befinden sich zwischen den heißen Sternen (Spektralklassen O, B, A) und den kühleren Sternen (Spektralklasse G, K, M). Anhand dieser Einteilung stellen diese Sterne einen Durchschnittsstern dar.
Die durchschnittliche Temperatur der F-Sterne soll im Bereich von rund 6.000 bis 7.000 Kelvin liegen. Dadurch haben sie keinen allzu hohen Energieverbrauch ihres Sternenmaterials. Das wiederum führt dann zu einer durchschnittlichen Leuchtkraft.
Die Oberflächen-Temperatur von Caph beträgt rund 7.080 Kelvin. Unsere Sonne hat eine Oberflächentemperatur von ca. 5.770 Kelvin (5.507 Grad Celsius).
Die Zahl 2 zeigt in welchem Temperaturbereich ein Stern sich befindet. Die Zahl 0 steht für die wärmsten Sterne, die Zahl 10 steht für die kühlen Sterne der jeweiligen Spektralklasse.
Caph wird mit den Zahl 2 als ein heißer Stern der Spektralklasse F eingestuft.
Die römische Ziffer zeigt die Leuchtkraftklasse eines Sterns an.
Diese beginnen bei VII und endet bei O. O sind die heißesten und hellsten Sterne, die am Anfang ihres Sternenlebens stehen, während VII für Sterne stehen, die ihr Leben hinter sich haben. Wobei die römische Ziffernfolge nicht die Reihenfolge eines Sternenlebens zeigt.
Caph wird als ein Riesenstern Leuchtkraftklasse III eingestuft.
Unsere Sonne ist ein Stern der Spektralklasse G2V (Zwergstern) und damit ein durchschnittlicher Hauptreihenstern in unserem Teil der Galaxis mit einem Alter von ca. 4,5 Mrd. Jahren und einer voraussichtlichen Lebensdauer von nochmals rund 8 Mrd. Jahren.
Ein Hauptreihenstern ist nicht eine Art von Stern, sondern bedeutet eine Zustandsart, in welcher der Stern seine meiste Lebenszeit verbringt. Unsere Sonne befindet sich noch mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium.
Die Umwandlung von Wasserstoff zu Helium geschieht jedoch schrittweise.
Bei unserer Sonne fusionieren im ersten Schritt zwei Protonen (zwei Wasserstoff-Kerne) zu einem Kern des schweren Wasserstoffs (Deuterium). Eigentlich dürfte eine solche Verschmelzung gar nicht vorkommen.
Da im Kern der Sonne die Temperaturen und der Druck sehr hoch sind, ist es aber unvermeidlich, dass zwei Protonen miteinander fusionieren. In der Chemie und Physik wird das Verbrennen eines Stoffes als Fusion bezeichnet.
Der folgenlose Zusammenstoß von Protonen im Kern passiert dauernd. Sehr selten sind jedoch die Fusionen. Daher auch der lange Zeitraum bis Wasserstoff zu Helium wird.
Bei der Fusion der Protonen wandelt sich eines der beiden Protonen in ein Neutron um, dass im Deuterium-Kern verbleibt, sowie in ein Positron und ein Neutrino, die beide den Atomkern verlassen.
Das Neutrino verlässt die Sonne als Strahlung. Die Neutrino-Strahlung erreicht auch unsere Erde, ist jedoch nur schwer nachweisbar. Das Positron zerstrahlt mit einem Elektron in zwei hochenergetische Photonen.
Im zweiten Schritt fusioniert der Deuterium-Kern ebenfalls wieder selten mit einem weiteren Proton zu einem Kern des leichten Helium-Isotops Helium-3. Dabei entsteht ein Gammaphoton außerhalb des Kerns.
Im dritten Schritt fusionieren schließlich zwei Helium-3-Kerne zu einem schweren Helium-4-Isotop. Dabei werden wieder zwei Protonen frei.
Damit wurde aus vier Protonen ein Helium-Kern. Im Rahmen der Fusionen wurde Energie in Form von hochenergetischen Photonen frei.
Bei unserer Sonne verwandeln sich so in einer Sekunde 564 Millionen Tonnen Wasserstoff in 560 Millionen Tonnen Helium. Die Masse von 4 Millionen Tonnen wird in Strahlungsenergie umgesetzt. Diese erreicht uns als Sonnenenergie und sorgt für unser Tageslicht.
Neben diesem, in drei Schritten stattfindenden Fusionsprozess, gibt es für die Fusion von Wasserstoff zu Helium noch einen weiteren Vorgang, den CNO-Zyklus.
Beim CNO-Zyklus, der nach seinen Entdeckern, den Physikern Hans Bethe und Carl Friedrich von Weizäcker auch „Bethe-Weizäcker-Zyklus“ genannt wird, werden in acht Schritten vier Wasserstoffkerne zu einem Helium-Kern fusioniert. Der Name CNO-Zyklus weist darauf hin, dass dieser Prozess unter der Verwendung von Kohlenstoff (C), Stickstoff (N) und Sauerstoff (O) stattfindet.
Ab einer Masse des 1,4- bis 1,6-fachen unserer Sonne wird über den CNO-Zyklus der größte Teil der Fusion von Wasserstoff zu Helium erfolgen.
Caph ist schon etwas weiter in der Entwicklung als unsere Sonne.
Im Rahmen der Umwandlung von Wasserstoff zu Helium verringerten sich die Teilchen im Kern des Sterns, gleichzeitig stieg aber die Atommasse von 0,5 auf 1,33 atomare Einheiten an.
Um das Temperatur- und Druckgleichgewicht aufrecht zu erhalten, kam es zu einer Verdichtung der Masse. Gleichzeitig wuchs die nukleare Energieproduktion und durch diese erhöhte sich auch die Leuchtkraft von Caph.
Dadurch gewann die Gravitation gegenüber dem Gasdruck die Oberhand. Das bedeutet, durch die Massenanziehung (Gravitation) verdichtet sich der Kern noch mehr. Dadurch kommt es zu einem Temperaturanstieg.
Caph befindet sich in der selten zu beobachtenden „Hertzsprung-Lücke“. Sie ist benannt nach Ejnar Hertzsprung.
Die Hertzsprung-Lücke ist ein Bereich im Hertzsprung-Russell-Diagramm, in dem sich sehr wenige Sterne befinden.
Wenn ein Stern während seiner Entwicklung die Hertzsprung-Lücke überquert, bedeutet dies, dass er die Kern-Wasserstoff-Fusion beendet hat, aber noch nicht mit der nächsten Stufe, der Wasserstoff-Schalenverbrennung begonnen hat. In einem Sternenleben ist dieser Stillstand eine sehr kurze Zeit von einigen tausend Jahren im Vergleich zu Dutzenden von Milliarden von Jahren für die Lebensdauer eines Sterns.
Als nächster Entwicklungsschritt beginnt das Wasserstoff-Schalenbrennen. Der Vorgang wurde aber von Caph noch nicht gestartet.
Caph besitzt zur Zeit die ca. 1,91-fache Masse, den ca. 3,43-fachen Radius und die ca. 27,3-fache Leuchtkraft unserer Sonne.
Seine Rotationsgeschwindigkeit beträgt ca. 71 km/s und er benötigt für eine Umdrehung ca. 1,12 Tage. Unsere Sonne hat eine Drehgeschwindigkeit von ca. 2 km/s und benötigt 25 Tage für eine Drehung.
Durch die für einen Stern seiner Spektralklasse sehr hohen Rotationsgeschwindigkeit ist Caph keine Kugel sondern eher ein Ei. Der Radius des Äquators ist ca. 24% größer als der Radius der Pole.
Da die Pole daher näher am heißen Kern des Sterns liegen ist die Temperatur dort um rund 1.000 Kelvin höher als in der Nähe des Äquators.
Bei einer 10% höheren Rotationsgeschwindigkeit würde Caph wahrscheinlich auseinandergerissen werden.
Caph weist eine visuelle durchschnittliche Helligkeit von 2,232691 mag auf die vom Satelliten Gaia gemessen wurde.
Für den Astrometrie-Satelliten GAIA ist es schwierig Sterne mit einer größeren Helligkeit als 3 mag zu vermessen. Daher wurde die überwiegende Mehrheit der Sterne mit einer visuellen Helligkeit zwischen 10 und 15,5 mag im G-Band gemessen. GAIA benutzt dabei eine eigene Definition der “G-Band-Magnitude“.
Die G-Band-Magnitude ist eine scheinbare Helligkeit von Himmelsobjekten wie sie von der Raumsonde Gaia gemessen wird.
Je höher der Wert ist, der in Magnituden (mag) gemessen wird, umso schwieriger kann ein Stern von uns gesehen werden. Ab einer Magnitude von mehr als ca. 6,0 ist ein Stern nur noch im Teleskop sichtbar.
Die Magnitudenzahl wurde in einem logarithmischen System entwickelt, um die Lichtschwäche eines Sterns darzustellen. Unsere Sonne hat eine visuelle Helligkeit von ca. -26,7 mag.
Die durchschnittliche absolute Helligkeit von Caph beträgt ca. 1,106 mag betragen. Die absolute Helligkeit wird aus einer Entfernung von 32,6 Lichtjahren gemessen; unsere Sonne hat eine absolute Helligkeit von 4,84 mag. 32,6 Lichtjahren entsprechen 10 Parsec, eine weitere astronomische Entfernungseinheit.
Laut der SIMBAD-Datenbank wird Caph als ein „Delta Scuti Stern“ eingestuft.
Delta-Scuti-Sterne sind pulsationsveränderliche Sterne der Spektralklassen A2 bis F8 und der Leuchtkraftklassen III bis V. Dabei verändern sie ihre Helligkeit innerhalb von 0,3 Tagen. Die Helligkeitsveränderungen können bis zu 0,8 mag erreichen. Die meisten Delta Scuti Sterne verändern ihre Helligkeit meistens nur um 0,02 mag.
Caph zeigt eine visuelle Helligkeitsveränderung von ca. 0,06 mag mit einer sich wiederholenden Periode von ca. 2,5 Stunden.
Bei Delta-Scuti-Sternen werden als Grund der Helligkeitsveränderungen die Pulsationskräfte des Sternes angenommen. Die Kraftquelle der Pulsationen ist zum größten Teil der sogenannte Kappa-Mechanismus.
Der Kappa-Mechanismus ist ein Pulsationsprozess, der die Helligkeitsänderungen von pulsationsveränderlichen Sternen (Veränderliche Sterne) beschreibt. Dieser Mechanismus kann dann in Kraft treten, wenn die Opazität (kappa) in der Sternenatmosphäre mit zunehmender Temperatur ansteigt.
Im Allgemeinen herrscht in einem Stern ein Kräftegleichgewicht.
Das heißt, die Gravitationskraft, die den Stern zu kontrahieren versucht (und der Stern sich dadurch zusammenzieht), wird ausgeglichen durch den Strahlungsdruck, der durch die Kernfusion im Inneren entsteht und nach außen drückt.
Ein optimaler Stern befindet sich im Gleichgewicht aus Gravitation und Druck.
Abweichungen von diesem Gleichgewicht können dazu führen, dass der Stern pulsiert. Ist zum Beispiel der Radius des Sterns kleiner, als es dem Gleichgewichtszustand entsprechen würde, überwiegt der Strahlungsdruck und der Stern expandiert und vergrößert seinen Radius.
Wegen der sogenannten „Massenträgheit“ führt diese rücktreibende Kraft dazu, dass der Stern sich dabei über den Gleichgewichtspunkt hinaus ausdehnt. Sobald der Strahlungsdruck nachlässt dominiert wieder die Gravitation und der Stern schrumpf wieder.
Es entsteht also eine Oszillation (lat. für schwingen, schwanken, schaukeln). Der Stern dehnt sich aus und zieht sich wieder zusammen, er pulsiert.
Bei den meisten Sternen (wie z. B. auch der Sonne) sind diese Pulsationen allerdings sehr klein. Die Stärke der Pulsation hängt daher von der Art der rücktreibenden Kraft ab.
Der Kappa-Mechanismus erzeugt eine rücktreibende Kraft, die dazu führt, dass ein Stern pulsiert. Im Inneren eines Sterns wird durch Kernfusion Energie in Form von Gammastrahlung erzeugt.
Diese Energie wird allerdings nicht direkt vom Stern abgestrahlt:
Wegen der hohen Dichte im Sterneninneren wird die Gammastrahlung auf ihrem Weg zur Oberfläche des Sterns vielfach gestreut. Diese teilweise Undurchlässigkeit der Sternenatmosphäre wird Opazität (lat. für Trübung, Beschattung) genannt und oft mit dem griechischen Buchstaben (kappa) bezeichnet.
Konstante Opazität bedeutet, dass die Gammastrahlung nicht nach außen dringen kann und im Stern verbleibt. Im Inneren eines Sterns ist die Opazität allerdings nicht konstant. Sie hängt vom Druck und der Temperatur ab und hat außerdem für jede Wellenlänge einen unterschiedlichen Wert.
Nimmt nun die Opazität mit zunehmender Temperatur des Sternenmaterials zu, können daraus Pulsationen entstehen. Der Kappa-Mechanismus lässt sich dann folgendermaßen beschreiben:
1. Schritt:
Das Material in einer Zone der Sternenatmosphäre, in der die Opazität (Undurchlässigkeit) mit steigender Temperatur zunimmt, wird durch äußere Störungen komprimiert, d.h. diese Schicht bewegt sich in Richtung des Zentrums des Sterns.
2. Schritt:
Durch die Kompression steigen Druck und Temperatur dieses Materials.
3. Schritt:
Durch die Erhöhung von Druck und Temperatur steigt die Opazität.
4. Schritt:
Durch die angestiegene Opazität dieser Schicht dringt nun weniger Strahlung aus dem Sterneninneren nach außen; sie "staut" sich darunter.
5. Schritt:
Dadurch entsteht unterhalb der Schicht ein größerer Strahlungsdruck, der dazu führt, dass die Schicht sich nun ausdehnt. Der Stern bläht sich auf.
6. Schritt:
Die sich ausdehnende Schicht wird nun kühler und der Druck sinkt. Der Stern zieht sich wieder zusammen, wodurch auch die Opazität wieder geringer wird. Jetzt kann die angestaute Strahlung schnell entweichen.
7. Schritt:
Durch das Entweichen der Strahlung nimmt der Druck unterhalb der Schicht ab, wodurch diese aufgrund der nun wieder stärkeren Gravitationskraft in Richtung des Sterninneren komprimiert wird und der Zyklus von neuem beginnt.
Der oben beschriebene Prozess lässt sich gut mit einer Dampfmaschine beschreiben, in der die Opazität einem Ventil entspricht. Sobald das Ventil geschlossen ist, hat der Druck keine Möglichkeit zu entweichen.
Caph kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 4,31 km/s aus uns zu.
2. Schedir (α- Alpha Cassiopeiae, 18 Cassiopeiae, HD 3712)
Schedir ist ein roter Riesenstern der Spektralklasse K0IIIa in einer Entfernung von 231,5 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 8,2 Lichtjahren.
Sterne der Spektralklasse K stehen für die orange-rot leuchtenden Sterne in einem Temperaturbereich von 3.500 bis 4.900 Kelvin. Aufgrund der nicht sehr hohen Temperaturen können Hauptreihensterne der Spektralklasse K mehr als 50 Mrd. Jahre alt werden.
Bei den kleinen Sternen der Spektralklasse K, mit ca. 50% bis 80 % der Masse unserer Sonne, wird vermutet, dass sie eventuell eine für Planeten lebensfreundlich Umgebung bieten könnten.
Allerdings sind sie aufgrund ihres geringen Energieverbrauchs und der damit verbundenen geringen Leuchtkraft nur sehr schwer zu beobachten. Im Regelfall sind die für uns sichtbaren Sterne der Spektralklasse K Riesensterne.
Sie sind für uns nur aufgrund der stark vergrößerten Oberfläche von meist weit mehr als 10 Sonnenradien zu sehen. Schedir besitzt die 4- bis 5-fache Masse und den ca. 42,1-fachen Radius unserer Sonne. Das sind rund 0,4 AE.
Die Spektralklasse K ist dadurch gekennzeichnet, dass sie starke Metalllinien zeigt. In der Astrophysik werden alle Elemente außer Wasserstoff und Helium als Metalle bezeichnet.
Die Spektren der Spektralklasse K zeichnen sich durch zahlreiche Absorptionslinien aus. Diese stammen meist von elementaren Metallen wie Kalzium (Ca I), Natrium (Na I) und Eisen (Fe I).
Die Wasserstofflinien der Balmerserie verlieren weiter an Stärke und sind daher nicht mehr gut erkennbar, da bei Sternen der Spektralklasse K im Regelfall die Wasserstoff-Fusion beendet ist.
Schedir ist in der Entwicklung schon einen Schritt weiter als Caph.
Nach dem Ende Kernfusion von Wasserstoff, dem Wasserstoff-Schalenbrennen, besaß Cap einen sehr stark verdichteten Kern.
Durch die hohe Dichte und Temperatur begann dann das Helium-Brennen.
Das heißt, es werden drei Helium-Kerne im Inneren des Sterns im Rahmen einer Kernfusion in Kohlenstoffe und Sauerstoff umgewandelt. Dabei wird Gammastrahlung ausgesendet.
Diese Kernfusion kann nur bei Temperaturen von über 100 Mio. Kelvin stattfinden.
Sobald die Kerntemperatur genügend hoch ist, wird die Entartung wieder aufgehoben. Dadurch, dass das Gas wieder „normal“ wird und der herrschende Gasdruck wieder temperaturabhängig ist, kommt es zu einer heftigen Expansion des Sterns. Der Stern dehnt sich aus und sein Umfang wird größer.
Die Hülle des Sterns ist aber in der Lage den Ausbruch abzufangen. Es kommt zu keiner Explosion des Sterns. Aber durch die Heftigkeit der Ausdehnung des Sterns werden die äußeren kühleren Schichten abgeworfen. Dadurch gelangen Materie und Gaswolken ins All, die wiederum zum Beginn von neuen Sternen werden können.
Schedir ist ein Stern im sogenannten „Horizontal Branch“ des Hertzsprung-Russell Diagramms (HRD). Dort befinden sich die Sterne, die bereits den „Red Giant Branch“ (der Rote Riesenast) hinter sich gelassen haben.
Bei Sternen, die zwischen 0,5 und 2,3 Sonnenmassen kommt es zum „Helium-Blitz“. Sie besitzen danach ähnlich Massen und Helligkeiten. Der Radius des Sterns und die Temperatur sind davon abhängig wie groß die Masse in der Wasserstoffhülle (Schale) um den Heliumkern ist. Ein Stern mit einer größeren Wasserstoffhüllen ist nicht so heiß und nicht so leuchtkräftig.
Bei Sternen zwischen 2,3 und 8 Sonnenmassen sind die Heliumkerne größer und entarten erst gar nicht. Die Fusion im Kern erfolgt ruhiger und wird von den Plasmaschichten des Sterns absorbiert (aufgenommen) und sind damit nicht mehr nach sichtbar.
Ab 8 Sonnenmassen erfolgt die Kernfusion im Heliumkern reibungsloser und es werden dann auch die schweren Elemente gebildet.
Die Oberflächen-Temperatur von Schedir beträgt ca. 5.075 Kelvin und er strahlt aufgrund der vergrößerten Oberfläche mit der rund 700-fachen Leuchtkraft unserer Sonne. Seine Rotationsgeschwindigkeit beträgt ca. 21 km/s.
Schedir weist eine visuelle Helligkeit von 1,942524 mag und eine absolute Helligkeit von ca. – 2,31 mag. Er kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 4,31 mag auf uns zu.
3. γ - Gamma Cassiopeiae (27 Cassiopeiae, HD 5394)
Gamma Cassiopeiae ist ein spektroskopisches Doppelsternsystem in einer Entfernung von etwa 381 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von rund + / - 40 Lichtjahren.
In einem spektroskopischen Doppelsternsystem stehen die beiden Sterne so nahe beieinander, dass es nicht möglich ist diese im Teleskop als zwei Sterne aufzulösen. Nur durch ihre Spektrallinien (unterschiedliche Wellenlängen des sichtbaren Lichts) können sie getrennt werden.
Gamma Cassiopeiae Aa wird in einer Entfernung von ca. 1,8 AE und einer Umlaufzeit von ca. 203,5 Tagen von Cassiopeiae Ab umrundet. Eine Astronomische Einheit (AE) ist die durchschnittliche Entfernung von der Sonne zur Erde. Diese beträgt ca. 149,6 Mio. km.
Das Doppelsternsystem ist der Namengeber der „Gamma-Cassiopeiae- Sterne“ (Gamma-Cas-Sterne).
Sie sind benannt nach dem Prototyp Gamma Cassiopeiae. Dabei handelt sich um eine Unterklasse der sogenannten „Eruptiver Veränderlicher“.
Bei eruptiven veränderlichen Sternen ändert sich die Helligkeit nicht in einer bestimmten Periode sondern unvermittelt (abrupt).
Die Helligkeitsveränderungen bei den Eruptiv Veränderlichen können verschiedene Gründen haben.
Die Gamma-Cas-Sterne sind sehr schnell rotierende Riesensterne. Sie zeigen dabei einen Materialabfluss durch Eruptionen, vergleichbar einem Vulkanausbruch bei uns auf der Erde. Dieses Material bildet um den Stern einen zirkumstellaren Ring aus Gas und Materie in Äquatornähe.
Gleichzeitig wird aus dem Ring wieder Material auf den Stern zurückgeführt. Es findet also eine Absorption und Reemission von ausgestoßener Materie statt. Das führt zu Schwierigkeiten die einzelnen Wellenlängen des Stern zu bestimmen.
Die Gamma-Cass-Sterne sind wiederum eine Untergruppe der „Be“-Sterne. Ein Be-Stern wird in die Leuchtkraftklasse V, IV oder III eingestuft. Die Buchstaben „Be“ bedeuten, es handelt sich um einen Stern der Spektralklasse „B“ und das „e“ steht für „emission lines“. Be-Sterne sind Sterne in einem früheren Stadium der Sternenentwicklung.
Sterne der Spektralklasse B sind sehr heiße Sterne, da sie ihren Wasserstoff sehr schnell fusionieren. Sie sind zwar selten, aufgrund ihrer Leuchtkraft werden aber ein Drittel der hellsten Sterne am Nachthimmel der Spektralklasse B zugerechnet.
Den größten Teil ihrer Strahlung senden sie aufgrund ihrer hohen Temperatur im ultravioletten Bereich aus. Diese hochenergetische Strahlung reicht ab der Spektralklasse B2 (bei einer Oberflächen-Temperatur von mehr als 20.000 Kelvin) aus, um das Leuchten von Emissionsnebeln anzuregen.
Gamma-Cas-Sterne zeigen mehrere Besonderheiten.
Zum einen zeigt ein Gamma-Cas-Stern ungewöhnlich hohe Röntgenleuchtkräfte, die zwischen denen normaler Be-Sterne und den Röntgen-Doppelsternen (bei denen ein Be-Stern als Massenspender für einen anderen Stern dient) liegen.
Dann gehören Gamma-Cass-Sterne noch zu den schnell rotierenden Riesensternen und gleichzeitig zur Gruppe der „Shell-Stars“. Shell-Stars sind von einer Hülle mit Material und Staub umgeben. Zwischenzeitlich gibt es auch hier einige Unterklassen.
Gamma Aa Cassiopeiae wird als Shell-Star eingestuft, der sowohl eine Schalen- als auch eine Emissionsaktivität zeigt. Hier spielt dann Gamma Ab eine Rolle.
Der Stern Gamma Ab Cassiopeiae befindet sich in der Schale um Gamma Aa und ist aller Wahrscheinlichkeit ein Neutronenstern.
Damit muss Gamma Ab einmal ein massiver Stern gewesen sein. Er wurde erst durch einen Kollaps seines Kerns zu einem Neutronenstern. Vor langer Zeit dürfe Gamma Ab als größerer Stern Masse auf Gamma Aa übertragen haben.
Gamma Ab wird wahrscheinlich ebenfalls von einer Schale umgeben sein. Durch seine hohe Rotationsgeschwindigkeit ist es ihm heute aber nicht möglich von der Schale die ihn umgibt Material aufzunehmen.
Durch diese ungewöhnlichen Verhältnisse des Doppelsternsystems lässt sich auch die Röntgenstrahlung des Sternensystems Gamma Cassiopeiae erklären.
Gamma Aa Cassiopeiae ist ein Unterriese der Spektralklasse B0.5Ive.
Unterriesen sind Sterne, die heller als ein normaler Hauptreihenstern strahlen, aber nicht so hell wie ein Riesenstern. Sie befinden im Regelfall am Ende der Wasserstoff-Fusion oder am Anfang der Helium-Fusion im Kern.
Dadurch dass der Wasserstoffanteil im Kern eines Hauptreihensterns immer geringer wird steigt die Kerntemperatur an. Damit leuchtet der Stern heller als während seiner Hauptreihen-Phase.
Gamma Aa besitzt wahrscheinlich die ca. 17-fache Masse und den ca. 10-fachen Radius unserer Sonne. Aufgrund der Masse gilt es als relativ sicher, dass Gamma Aa in ferner Zukunft als Supernova enden wird.
Die Oberflächen-Temperatur von Gamma Aa beträgt ca. 25.000 Kelvin und er strahlt mit der ca. 34.000-fache Leuchtkraft unserer Sonne.
Er dreht sich mit einer sehr hohen Rotationsgeschwindigkeit von ca. 432 km/s. Damit gleicht die Form von Gamma Aa eher einem Ei.
Gamma Cassiopeiae Aa weist eine durchschnittliche visuelle Helligkeit von 2,064583 mag auf. Durch die Helligkeitsausbrüche zeigt er eine visuelle Helligkeit zwischen 1,6 und 3,0 mag. Seine durchschnittliche absolute Helligkeit beträgt ca. - 3,276 mag.
Bei den Gamma-Cass-Sternen entstehen die Helligkeitsveränderungen durch Eruptionen. Die Ausbrüche entstehen durch die Bildung einer sogenannten Pseudo-Photosphäre in einem Ring um den Äquator des B-Sterns.
Der Begriff Pseudo-Photosphäre wird häufig im Zusammenhang mit der Strahlung verwendet, die beim Transfer von Masse bei einer Supernova vorkommt. Bei Gamma-Cass-Sternen wird damit die Region der Scheibe um den Stern bezeichnet.
Das Doppelsternsystem hat ein einer Entfernung von ca. 370 AE noch einen weiteren Begleiter. Es wird angenommen, dass er in einer physischen Verbindung mit dem Doppelsternsystem steht. Der Stern Gamma B ist Zwergstern der Spektralklasse F6 mit einer visuellen Helligkeit von ca. 11 mag.
Bei dem Stern Gamma C wird angenommen, dass er nur visuelle in einer Sichtlinie mit dem Sternensystem Gamma Cassiopeia steht. Er hat eine visuelle Helligkeit von ca. 13 mag.
Das Doppelsternsystem kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 6,8 km/s auf uns zu.
4. Ruchbah (δ - Delta Cassiopeiae, 37 Cassiopeiae, HD 8538)
Ruchbah ist ein Doppelsternsystem in einer Entfernung von 101,8 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 1,27 Lichtjahren.
Delta Aa und Ab sind rund 2,1 AE voneinander entfernt mit einer Umlaufzeit von ca. 759 Tagen.
Ruchbah ist ein elliptisches Doppelsternsystem vom Typ Algol.
Algol (Beta Persei) ist der Namensgeber der „Algol-Sterne“. Algol-Sterne sind im Regelfall Doppelsternsysteme, bei denen die beiden Sterne so in einer visuellen Sichtlinie zu uns stehen, dass sich die beiden auf ihrer Umlaufbahn gegenseitig bedecken. Der Vorgang läuft genauso ab wie bei einer Sonnenfinsternis auf der Erde.
Die Dauer der Helligkeitsveränderungen und die regelmäßigen Perioden lassen sich genau berechnen. Beim Doppelsternsystem Algol findet alle 2 Tage, 20 Stunden und 49 Minuten eine Bedeckung statt.
Die Helligkeitsveränderungen bei den Algol-Sternen kann dabei mehrere Magnituden (mag) betragen.
Daneben kann es neben der Helligkeitsveränderung durch Bedeckung auch noch zu einer Übertragung von Masse von einem Stern auf den anderen geben, wenn die beiden Sterne sehr nahe beieinander stehen.
Das Doppelsternsystem Delta A weist eine visuelle Helligkeit von 2,680530 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,21 mag auf. Die Helligkeitsveränderung aufgrund der Bedeckung beträgt ca. 0,07 mag.
Die Bedeckung des dunkleren Sterns durch den Helleren ist bei uns visuell kaum erkennbar.
Delta Aa ist ein Unterriese der Spektralklasse A5IV. Er besitzt die ca. 2,49-fache Masse und den ca. 3,9-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt etwa 7.980 Kelvin und er hat die rund 63-fache Leuchtkraft unserer Sonne.
Über Delta Ab ist nichts bekannt.
Das Doppelsternsystem wird in einer Entfernung von ca. 88 AE von einer Staub- und Trümmerscheibe umrundet.
Die Trümmerscheiben bestehen im Regelfall aus Staub und kleinerem Material. Aus diesen Scheiben kommt zusätzliche Infrarotstrahlung. Sie ist das Ergebnis von thermischer Strahlung, die von den Staubteilchen abgeben wird.
Die Staubteilchen wurden wiederum von der elektromagnetischen Strahlung des Sterns erwärmt.
Im Allgemeinen besitzen die Trümmerscheiben eine Dicke von weniger als 0,1 AE. Sie können jedoch einen Durchmesser von bis 120 AE erreichen.
Die gefundenen Mineralien der Trümmerscheiben entsprechen den Kometen unseres äußeren Sonnensystems.
Die „warmen“ Trümmerscheiben befinden sich in einem Abstand von einigen AE. Ihre Temperatur liegt zwischen 100 bis 150 Kelvin.
Die „kalten“ Trümmerscheiben befinden sich in einem Abstand von etwa 30 bis 120 AE. Sie zeigen zum Teil eine Temperatur im Bereich von 20 Kelvin. Das ist der Temperaturbereich des Staubs im Kuipergürtel.
Laut dem WDS-Katalog werden der WDS-Nr. J01258+6014 zwei Sterne zu geordnet.
TYC 4031-1418-1 (WDS J01258+6014B)
TYC 4031-1418-1 ist wahrscheinlich ein Stern der Spektralklasse K in einer Entfernung von 1.458 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 11,5 Lichtjahren. Er besitzt den ca. 2,78-fachen Radius unserer Sonne.
Die Oberflächen-Temperatur von TYC 4031-1418-1 beträgt ca. 4.868 Kelvin und er strahlt mit der rund 4-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
TYC 4031-1418-1 weist eine visuelle Helligkeit von 11,649789 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 3,40 mag auf. Er kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 12,66 km/s auf uns zu.
Delta Cassiopeia wird dem Offenen Sternhaufen Melotte 25 und den Hyaden zugerechnet.
5. Segin (ε - Epsilon Cassiopeiae, 45 Cassiopeiae, HD 11415)
Segin ist ein weiß-blau leuchtender Hauptreihenstern der Spektralklasse B3Vp in einer Entfernung 465,7 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 16,5 Lichtjahren Entfernung.
Er befindet sich noch mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium.
Segin zeigt Anzeichen eines sogenannten „Be“-Sterns. Er wird wahrscheinlich aus einer Hülle von Staub und Material umgeben, die von ihm selbst stammen.
Als Be-Stern sollte er eigentlich eine hohe Rotationsgeschwindigkeit besitzen. Tatsächlich beträgt sie nur ca. 30 km/s. Laut Simbad wird er noch sogenannter „Bp“-Stern eingestuft.
Die Bp-Sterne sind chemisch eigenartige Sterne (das "p" steht für peculiar (eigenartig)) der Spektralklasse B.
Sie zeigen eine erhöhte Konzentration von Metallen wie Strontium, Chrom, Mangan und einiger seltener Erden. Ihre Rotation ist langsamer, als die normalerweise bei Sternen der Spektralklasse B üblich. Dadurch haben dann die verschiedenen chemischen Elemente eher die Möglichkeit vom Kern Richtung Oberfläche zu wandern.
Im Regelfall besitzen die Bp-Sterne auch ein größeres Magnetfeld.
Segin besitzt die ca. 9,2-fache Masse und etwa den 6-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt etwa 15.170 Kelvin und er strahlt mit der rund 2.500-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
Segin weist eine visuelle Helligkeit von ca. 3,354666 mag und eine absolute Helligkeit von ca. – 2,42 mag auf. Er kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 8,3 km/s auf uns zu.
Die Bp-Sterne sind oftmals pulsierende veränderliche Sterne mit einer kaum wahrnehmbaren Helligkeitsveränderung. Bei Segin wurden eine Helligkeitsveränderung von 0,0025 mag in eine Zeitraum von rund 2,15 Stunden gemessen.
Aufgrund von Raumgeschwindigkeits-Messungen wird Segin dem „Cassiopeia-Taurus-Verbund“ zugerechnet.
Dieser Sternengruppe werden lt. der SIMBAD-Datenbank 82 Sterne der Spektralklasse B zu gerechnet. Er soll sich über rund 4.000 Lichtjahre vom Sternbild Stier bis ins Sternbild Kassiopeia hinein erstrecken. Die Mitte des Sternenverbandes wird im Sternbild Perseus verortet, im „Alpha-Persei-Cluster“.
Der Alpha-Persei-Cluster ist ein offener Sternhaufen im Sternbild Perseus mit einem Alter von 50 bis 70 Mio. Jahren.
Es wird vermutet das Segin im Alpha-Persei-Cluster entstanden ist.