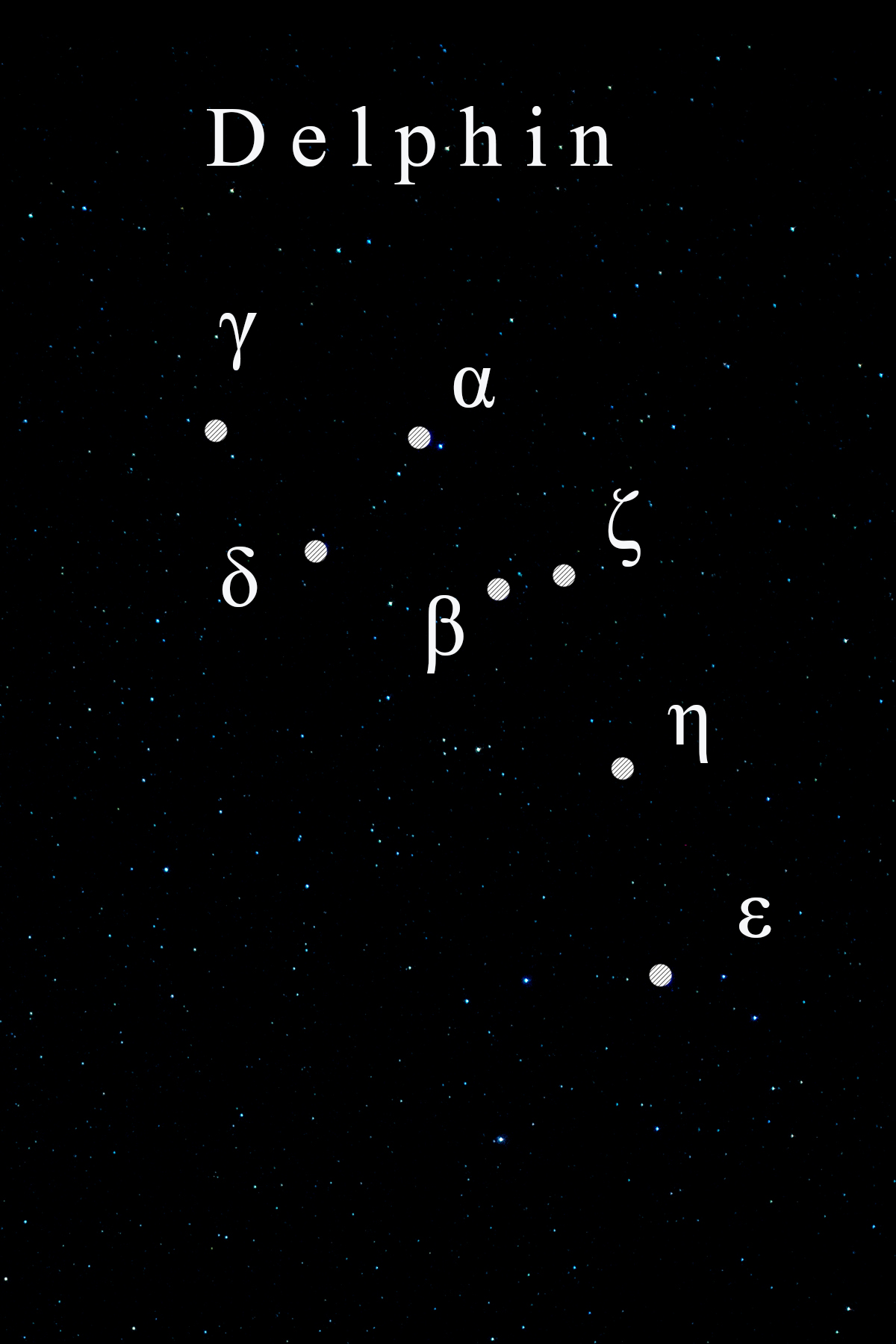1. Sualocin (α Delphini, 9 Delphini, HD 196867)
Alpha Delphini ist ein spektroskopisches Mehrfach-Sternensystem in einer Entfernung von 218 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 7,76 Lichtjahren.
Es besteht aus dem Doppelsternsystem Ab und dem Stern Aa.
In einem spektroskopischen Doppel- und Mehrfachsternsystem stehen die Sterne so nahe beieinander, dass es nicht möglich ist diese im Teleskop einzeln aufzulösen. Nur durch ihre Spektrallinien (unterschiedliche Wellenlängen des sichtbaren Lichts) können sie getrennt werden.
Das Doppelsternsystem Ab und der Stern Aa sind ca. 12 AE voneinander entfernt. Eine Astronomische Einheit (AE) ist die durchschnittliche Entfernung von der Sonne zur Erde. Diese beträgt ca. 149,6 Mio. km. Die Umlaufzeit beträgt ca. 12,92 Jahre (6.175 Tage mit einer Unsicherheit von 3,2 Tagen).
Im Doppelsternsystem Ab sind die beiden Sterne Ab1 und Ab2 ca. 0,281 AE von einander entfernt mit einer Umlaufzeit von rund 30 Tagen.
Laut dem WDS-Katalog werden Alpha Delphini noch 5 weitere Sterne zu gerechnet. Dabei handelt es sich jedoch nur um visuelle Hintergrundsterne.
Der Washington Double Star Catalog (WDS-Catalog) enthält mehr 150.000 Einträge von Mehrfach-Sternensystemen. Zu meist handelt es sich um Sternensysteme, bei denen die Sterne nur visuell beieinander stehen.
Alpha A
Alpha Aa Delphini ist ein weiß-blau leuchtender Unterriese der Spektralklasse B9IV.
Spektralklassen werden dazu verwendet, um einen Stern in einer bestimmten Gruppe zusammenzufassen, wobei in der Bezeichnung auch schon eine relativ genaue Aussage zu den Eigenschaften des Sterns getroffen wird. Denn es werden weitere Unterteilungen vorgenommen.
Die Einteilung der Spektralklassen beruht bis heute auf der Basis, die im 19. Jahrhundert gelegt wurde. Zwischenzeitlich wurde das System immer mehr verfeinert, so dass anhand der Spektralklasse schon eine grobe Zusammenfassung über einen Stern möglich ist.
Alpha Aa wird laut der SIMBAD-Datenbank in der Spektralklasse B (lateinischer Buchstabe) verortet. In früheren Zeiten wurde angenommen, dass Sterne der Spektralklasse B am Anfang ihrer Entwicklung stehen.
Sterne der Spektralklasse B sind sehr heiße Sterne, da sie ihren Wasserstoff sehr schnell fusionieren. Sie sind zwar selten, aufgrund ihrer Leuchtkraft werden aber ein Drittel der hellsten Sterne am Nachthimmel der Spektralklasse B zugerechnet.
Den größten Teil ihrer Strahlung senden sie aufgrund ihrer hohen Temperatur im ultravioletten Bereich aus. Diese hochenergetische Strahlung reicht ab der Spektralklasse B2 (bei einer Oberflächen-Temperatur von mehr als 20.000 Kelvin) aus, um das Leuchten von Emissionsnebeln anzuregen.
Die Zahl 9 zeigt in welchem Temperaturbereich ein Stern sich befindet. Die Zahl 0 steht für die wärmsten Sterne, die Zahl 10 steht für die kühlen Sterne der jeweiligen Spektralklasse.
Alpha Aa wird mit den Zahl 9 als ein kühler Stern der heißen Spektralklasse B eingestuft.
Die Oberflächen-Temperatur von Alpha Aa beträgt ca. 11.640 Kelvin und er strahlt mit der rund 120-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
Die römische Ziffer zeigt die Leuchtkraftklasse eines Sterns an.
Diese beginnen bei VII und endet bei O. O sind die heißesten und hellsten Sterne, die am Anfang ihres Sternenlebens stehen, während VII für Sterne stehen, die ihr Leben hinter sich haben. Wobei die römische Ziffernfolge nicht die Reihenfolge eines Sternenlebens zeigt.
Alpha Aa wird als ein Unterriese der Leuchtkraftklasse IV eingestuft.
Unsere Sonne ist ein Stern der Spektralklasse G2V (Zwergstern) und damit ein durchschnittlicher Hauptreihenstern in unserem Teil der Galaxis mit einem Alter von ca. 4,5 Mrd. Jahren und einer voraussichtlichen Lebensdauer von nochmals rund 8 Mrd. Jahren.
Ein Hauptreihenstern ist nicht eine Art von Stern, sondern bedeutet eine Zustandsart, in welcher der Stern seine meiste Lebenszeit verbringt. Unsere Sonne befindet sich noch mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium.
Die Umwandlung von Wasserstoff zu Helium geschieht jedoch schrittweise.
Bei unserer Sonne fusionieren im ersten Schritt zwei Protonen (zwei Wasserstoff-Kerne) zu einem Kern des schweren Wasserstoffs (Deuterium). Eigentlich dürfte eine solche Verschmelzung gar nicht vorkommen.
Da im Kern des Sterns die Temperaturen und der Druck sehr hoch sind, ist es aber unvermeidlich, dass zwei Protonen miteinander fusionieren. In der Chemie und Physik wird das Verbrennen eines Stoffes als Fusion bezeichnet.
Der folgenlose Zusammenstoß von Protonen im Kern passiert dauernd. Sehr selten sind jedoch die Fusionen. Daher auch der lange Zeitraum bis Wasserstoff zu Helium wird.
Bei der Fusion der Protonen wandelt sich eines der beiden Protonen in ein Neutron um, dass im Deuterium-Kern verbleibt, sowie in ein Positron und ein Neutrino, die beide den Atomkern verlassen.
Das Neutrino verlässt die Sonne als Strahlung. Die Neutrino-Strahlung erreicht auch unsere Erde, ist jedoch nur schwer nachweisbar. Das Positron zerstrahlt mit einem Elektron in zwei hochenergetische Photonen.
Im zweiten Schritt fusioniert der Deuterium-Kern ebenfalls wieder selten mit einem weiteren Proton zu einem Kern des leichten Helium-Isotops Helium-3. Dabei entsteht ein Gammaphoton außerhalb des Kerns.
Im dritten Schritt fusionieren schließlich zwei Helium-3-Kerne zu einem schweren Helium-4-Isotop. Dabei werden wieder zwei Protonen frei.
Damit wurde aus vier Protonen ein Helium-Kern. Im Rahmen der Fusionen wurde Energie in Form von hochenergetischen Photonen frei.
Bei unserer Sonne verwandeln sich so in einer Sekunde 564 Millionen Tonnen Wasserstoff in 560 Millionen Tonnen Helium. Die Masse von 4 Millionen Tonnen wird in Strahlungsenergie umgesetzt. Diese erreicht uns als Sonnenenergie und sorgt für unser Tageslicht.
Neben diesem, in drei Schritten stattfindenden Fusionsprozess, gibt es für die Fusion von Wasserstoff zu Helium noch einen weiteren Vorgang, den CNO-Zyklus.
Beim CNO-Zyklus, der nach seinen Entdeckern, den Physikern Hans Bethe und Carl Friedrich von Weizäcker auch „Bethe-Weizäcker-Zyklus“ genannt wird, werden in acht Schritten vier Wasserstoffkerne zu einem Helium-Kern fusioniert. Der Name CNO-Zyklus weist darauf hin, dass dieser Prozess unter der Verwendung von Kohlenstoff (C), Stickstoff (N) und Sauerstoff (O) stattfindet.
Ab einer Masse des 1,4- bis 1,6-fachen unserer Sonne wird über den CNO-Zyklus der größte Teil der Fusion von Wasserstoff zu Helium erfolgen.
Alpha Aa besitzt die ca. 3,9-fache Masse und den ca. 5,92 fachen Radius unserer Sonne.
Alpha Aa ist bereits eine Stufe weiterentwickelt als unsere Sonne.
In seiner Hauptreihenphase verringerten sich, wie bei unserer Sonne zur Zeit auch, während der steten Umwandlung von Wasserstoff zu Helium die Teilchen im Kern des Sterns.
Gleichzeitig ist aber die Atommasse von 0,5 auf 1,33 atomare Einheiten angestiegen, da der Helium-Kern mehr als 4-mal so schwer ist wie ein Wasserstoffkern. Um das Temperatur- und Druckgleichgewicht weiterhin aufrecht zu erhalten, kommt es zu einer Verdichtung der Masse. Damit wächst die nukleare Energieproduktion und durch diese erhöhte sich auch die Leuchtkraft von Alpha Aa.
Im bisherigen Gleichgewicht von Gravitation und Gasdruck gewann die Gravitation gegenüber dem Gasdruck die Oberhand. Das bedeutet, durch die Massenanziehung (Gravitation) verdichtet sich der Kern noch mehr. Dadurch kommt es zu einem Temperaturanstieg.
Durch den Temperaturanstieg wegen der Verdichtung im Kern setzte in der bisher inaktiven Wasserstoffhülle von Alpha Aa die Kernfusion ein. Auch in der Hülle wird aus dem Wasserstoff Helium.
Das Verbrennen des Wasserstoffs vom Kern zur Hülle wird Wasserstoff-Schalenbrennen genannt (wie die Schalen einer Zwiebel). Dadurch wird die Hülle des Sterns weiter nach außen getrieben und der Radius des Sterns wächst an. Alpha Aa befindet sich nun in der Leuchtkraftklasse IV, der Klasse der Unterriesen.
Unterriesen sind Sterne, die heller als ein normaler Hauptreihenstern strahlen, aber nicht so hell wie ein Riesenstern. Sie befinden im Regelfall am Ende der Wasserstoff-Fusion oder am Anfang der Helium-Fusion im Kern.
Alpha Aa weist eine visuelle Helligkeit von 3,637 mag auf, die im G-Band des Astrometrie-Satelliten GAIA gemessen wurde. Für den Astrometrie-Satelliten GAIA ist es schwierig Sterne mit einer größeren Helligkeit als 3 mag zu vermessen.
Daher wurde die überwiegende Mehrheit der Sterne mit einer Helligkeit zwischen 10 und 15,5 mag im G-Band gemessen. GAIA benutzt dabei eine eigene Definition der “G-Band-Magnitude“.
Die visuelle Helligkeit unserer Sonne beträgt ca. – 26,7 mag. Je höher der Wert ist, der in Magnituden (mag) gemessen wird, umso schwieriger kann ein Stern von uns gesehen werden. Ab einer Magnitude von mehr als ca. 6,0 ist ein Stern nur noch im Teleskop sichtbar.
Die absolute Helligkeit von Alpha Aa beträgt ca. – 0,488 mag (die absolute Helligkeit wird aus einer fiktiven Entfernung von 32,6 Lichtjahren gemessen; unsere Sonne hat eine absolute Helligkeit von 4,84 mag. Bei einer Entfernung von nur rund 32 Lichtjahren, wäre Alpha Aa einer der hellsten Sterne am Nachthimmel.
Alpha Aa dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 144 km/s. Unsere Sonne hat eine Drehgeschwindigkeit von ca. 2 km/s und benötigt ca. 25 Tage für eine Drehung.
Die hohe Rotationsgeschwindigkeit von Alpha Aa befindet sich für einen Stern seiner Spektralklasse im Normalbereich.
Alpha B
Das rund 12AE von Alpha Aa entfernt liegende Doppelsternsystem Alpha Ab besteht aus den Sternen Alpha Ab1 und Ab2.
Alpha Ab1 ist wahrscheinlich ein Stern der Spektralklasse A mit der ca. 1,82-fachen Masse unser Sonne. Alpha Ab2 besitzt wahrscheinlich die 1,49-fache Masse.
Mehr ist über das Doppelsternsystem Ab nicht bekannt.
Das Sternensystem Sualocin kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 3,4 km/s auf uns zu.
Neben dem Mehrfach-Sternensystem Alpha A sind unter der WDS-Nr. J20396+1555 noch fünf weitere Sterne vermerkt, bei denen es sich allerdings nur um visuell nahestehende Sterne zu Alpha A handelt.
UCAC3 212-298698 (WDS J20396+1555B, Alpha B)
UCAC3 212-298698 ist wahrscheinlich ein Stern der Spektralklasse K in einer Entfernung von 6.015 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 160 Lichtjahren. Er besitzt den ca. 5,56-fachen Radius unserer Sonne.
Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.870 Kelvin und er strahlt mit der ca. 15,67-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
Sterne der Spektralklasse K stehen für die orange-rote leuchtenden Sterne in einem Temperaturbereich von 3.500 bis 4.900 Kelvin.
Im Regelfall sind die für uns sichtbaren Sterne der Spektralklasse K Riesensterne. Sie sind für uns nur aufgrund der vergrößerten Oberfläche wegen der geringen Leuchtkraft der Sterne zu beobachten.
UCAC3 212-298698 weist eine visuelle Helligkeit von 13,443455 mag auf, die im G-Modus des GAIA-Satelliten gemessen wurde. Seine absolute Helligkeit beträgt ca. 2,115 mag.
UCAC2 37451349 (WDS J20396+1555C)
UCAC2 37451349 ist wahrscheinlich ein Stern der Spektralklasse G in einer Entfernung von 975 Lichtjahren Entfernung mit einer Abweichung von + / - 4,84 Lichtjahren.
Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 5.635 Kelvin. Er besitzt den ca. 1,15-fachen Radius und die ca. 1,21-fache Leuchtkraft unserer Sonne.
Im Regelfall befinden sich Sterne der Spektralklasse G in einem Temperaturbereich von 4.900 bis 6.000 Kelvin. Durch diese nicht allzu hohen Temperaturen haben Sterne ähnlich unserer Sonne keinen großen Energieverbrauch und können mehr als 10 Mrd. Jahre alt werden.
UCAC2 37451349 weist eine visuelle Helligkeit von 11,848540 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 4,47 mag auf.
Er kommt mit einer Radialgeschwindigkeit 18,10 km/s auf uns zu.
UCAC3 212-298729 (WDS J20396+1555D)
UCAC3 212-298729 ist wahrscheinlich ein Stern der Spektralklasse G in einer Entfernung von 5.345 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 114 Lichtjahren. Er besitzt den ca. 7,45-fachen Radius unserer Sonne.
Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 5.000 Kelvin und er strahlt mit der ca. 31,26-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
UCAC3 212-298729 weist eine visuelle Helligkeit von 12,215980 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 1,143 mag auf.
Er kommt mit einer Radialgeschwindigkeit 33,85 km/s auf uns zu.
UCAC3 212-298682 (WDS J20396+1555E)
UCAC3 212-298682 ist wahrscheinlich ein Stern der Spektralklasse K in einer Entfernung von 10.151 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 445,5 Lichtjahren.
Er besitzt den ca. 8,26-fachen Radius und die ca. 34-fache Leuchtkraft unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.850 Kelvin.
UCAC3 212-298682 weist eine visuelle Helligkeit von 13,426703 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,961 mag auf.
UCAC3 212-298752 (WDS J20396+1555E)
UCAC3 212-298752 ist wahrscheinlich ein Stern der Spektralklasse G in einer Entfernung von 5.286 Lichtjahre mit einer Unsicherheit von + / - 185,5 Lichtjahren. Er besitzt den ca. 10,56-fachen Radius unserer Sonne.
Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.930 Kelvin und er strahlt mit der ca. 59,26-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
UCAC3 212-298752 weist eine visuelle Helligkeit von 11,597364 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,556 mag auf.
Er kommt mit einer Radialgeschwindigkeit 51,17 km/s auf uns zu.
2. Rotanev (β – Beta Delphini, 6 Delphin, HD 196524)
Rotanev ist ein spektroskopisches Doppelsternsystem in ca. 100,9 Lichtjahren Entfernung.
Die Umlaufzeit von Beta A und Beta B Delphini beträgt ca. 26,65 Jahre. Da die Umlaufbahn nicht rund ist, sondern einer Ellipse mit einer hohen Exzentrizität von 0,36 folgt, sind die beiden Sterne zwischen 8 und 26,7 AE von einander entfernt.
Das Doppelsternsystem wird auf ein Alter von ca. 1,8 Mrd. Jahre geschätzt und kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 32,6 km/s auf uns zu.
Beta A ist wahrscheinlich ein Unterriese der Spektralklasse F5IV. Im „Catalogue of Ap, HgMn and Am stars“ verfügt er noch über den Zusatz „sr“, was bedeutet, daß in seinem Spektrum ein erhöhter Wert von Strontium gefunden wurde. Auch ein erhöhter Wert an Lithium wurde in ihm entdeckt.
Beta A besitzt die ca. 1,75-fache Masse und den ca. 2-fachen Radius.
Die Sterne der Spektralklasse F befinden sich zwischen den heißen Sternen (Spektralklassen O, B, A) und den kühleren Sternen (Spektralklasse G, K M). Anhand dieser Einteilung stellen diese Sterne einen Durchschnittsstern dar.
Ihre durchschnittliche Temperatur soll im Bereich von rund 6.000 bis 7.000 Kelvin liegen. Dadurch zeigen sie keinen allzu hohen Energieverbrauch ihres Sternenmaterials. Das wiederum führt dann zu einer durchschnittlichen Leuchtkraft.
Die Oberflächen-Temperatur von Beta A beträgt ca. 6.587 Kelvin und er strahlt mit der ca. 24-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
Während bei den Sterne der Klassen O, B und A im Rahmen des sogenannten „CNO-Zyklus“ der größte Teil des Wasserstoffs in Helium umwandeln wird, erfolgt dies bei den Sternen der Spektralklassen Klassen F und G (unsere Sonne ist ein Stern der Spektralklasse G2V) im Rahmen der vier Schritte durch die sogenannte „Proton-Proton-Reaktion“.
Beta A sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 49,8 km/s.
Er weist eine visuelle Helligkeit von ca. 3,62 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,12 mag.
Beta B ist ein Unterriese der Spektralklasse F2IV.
Er besitzt die ca. 1,47-fache Masse und die ca. 8-fache Leuchtkraft unserer Sonne. Seine Rotationsgeschwindigkeit wird auf rund 40 km/s geschätzt
Beta B weist eine visuelle Helligkeit von ca. 5,01 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 2,79 mag auf.
Noch liegen die neuesten Daten des GAIA-DR-Katalogs nicht vor. Anhand der Daten ist dann mit eventuellen Änderungen zu rechnen.
Laut dem WDS-Katalog werden Beta Delphini insgesamt fünf Sterne zugeordnet, wobei die Sterne C bis E nur visuell in der Nähe des Doppelsternsystems Beta AB stehen.
TIC 456645656 (WDS J20375+1436C)
TIC 456645656 ist wahrscheinlich ein Stern der Spektralklasse G in einer Entfernung von 2.104,4 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von 19,69 Lichtjahren.
Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 5.906 Kelvin. Er besitzt den ca. 2-fachen Radius und die ca. 4,43-fache Leuchtkraft unserer Sonne.
TIC 456645656 weist eine visuelle Helligkeit von 12,132249 mag und eine absolute Helligkeit von 3,084 mag auf.
UCAC3 210-293491 (WDS J20375+1436D)
UCAC3 210-293491 ist wahrscheinlich ein Roter Riesenstern der Spektralklasse K in 3.038,85 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 40,8 Lichtjahren. Er besitzt den ca. 9,5-fachen Radius unserer Sonne.
Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.761 Kelvin und er strahlt mit der ca. 42,07-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
UCAC 210-293491 weist eine visuelle Helligkeit von 10,588109 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,74 mag auf. Er entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 8,16 km/s.
GSC 01100-00703 (WDS J20375+1436E)
GSC 01100-00703 ist wahrscheinlich ein Stern der Spektralklasse F in einer Entfernung von 1.297,23 Lichtjahre mit einer Unsicherheit von + / - 6,97 Lichtjahren. Er besitzt den ca. 1,08-fachen Radius unserer Sonne.
Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 6.314 Kelvin und er strahlt mit der ca. 1,66-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
GSC 01100-00703 weist eine visuelle Helligkeit von 12,097854 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 4,1 mag auf.
3. γ - Gamma Delphini (12-Delphini, HD 197963 + HD 197964)
Gamma Delphini ist ein Doppelsternsystem.
Bisher wird angenommen das die beiden Sterne eine Umlaufzeit von ca. 5.200 Jahren aufweisen. Die Umlaufbahn folgt dabei jedoch keinem Kreis, sondern einer Ellipse mit einer hohen Exzentrizität. Dabei sind die beiden Sterne zwischen ca. 38 und 450 AE voneinander entfernt.
Anhand der Daten des Astrometrie-Satelliten GAIA und den Daten des GAIA-DR2-Katalog sind die beiden Sterne jedoch weiter voneinander entfernt.
Gamma A ist ein Stern der Spektralklasse F8V in einer Entfernung von 116,95 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 0,3718 Lichtjahren.
Gamma B ist ein Stern der Spektralklasse K1IV in einer Entfernung von 115,92 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 0,1825 Lichtjahren.
Wenn die Daten korrekt sind ist die Entfernung zwischen den beiden Sternen größer und die Umlaufdauer wahrscheinlich länger. Ein Lichtjahr umfasst rund 63.241 AE.
Gamma A ist ein Hauptreihenstern der Spektralklasse F8V. Er besitzt die ca. 1,57-fache Masse und den ca. 2,54-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 6.296 Kelvin und er leuchtet mit der ca. 9,16-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
Gamma A ist ein sogenannter “High Proper Motion Star“.
Diese Sterne zeigen im Vergleich zu anderen Sternen in ihrer unmittelbaren visuellen Nähe eine größere Bewegung am Nachthimmel. Der Stern mit der größten Eigenbewegung ist Barnards Pfeilstern mit einer Bewegung von 10,4 Bogensekunden pro Jahr. Seine Geschwindigkeit wird auf etwa 140 km/s geschätzt.
Gamma A kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 6,97 km auf uns zu.
Gamma ist ein Mitglied des Offenen Sternhaufens “Wolf 630 Moving Group“, der laut der SIMBAD-Datenbank insgesamt 35 Mitglieder zugerechnet werden.
Zu einem Offenen Sternhaufen werden zum Teil mehrere tausend Sterne, die alle in der gleichen Molekülwolke geboren wurden, zugerechnet. Sie sind meist nicht oder nur sehr gering gravitativ aneinandergebunden.
Gamma B ist ein Unterriese der Spektralklasse K1IV.
Sterne der Spektralklasse K stehen für die orange-rote leuchtenden Sterne in einem Temperaturbereich von 3.500 bis 4.900 Kelvin. Die Oberflächen-Temperatur von Gamma B beträgt 4.676,5 Kelvin.
Aufgrund der nicht sehr hohen Temperaturen können Hauptreihensterne der Spektralklasse K mehr als 50 Mrd. Jahre alt werden.
Bei den kleinen Sternen der Spektralklasse K, mit ca. 50 bis 80 % der Masse unserer Sonne, wird vermutet, dass sie eventuell eine für Planeten lebensfreundlich Umgebung bieten könnten.
Allerdings sind sie aufgrund ihres geringen Energieverbrauchs und der damit verbundenen geringen Leuchtkraft nur sehr schwer zu beobachten. Im Regelfall sind die für uns sichtbaren Sterne der Spektralklasse K Riesensterne. Sie sind für uns nur aufgrund der stark vergrößerten Oberfläche von meist weit mehr als 10 Sonnenradien zu sehen.
Gamma B besitzt die ca. 1,72-fache Masse und den ca. 8,3-fachen Radius unsere Sonne. Aufgrund der vergrößerten Oberfläche strahlt er mit der ca. 29,6-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
Die Spektralklasse K ist dadurch gekennzeichnet, dass sie starke Metalllinien zeigt.
Die Spektren der Spektralklasse K zeichnen sich durch zahlreiche Absorptionslinien aus. Diese stammen meist von elementaren Metallen wie Kalzium (Ca I), Natrium (Na I) und Eisen (Fe I).
Die Wasserstofflinien der Balmerserie verlieren weiter an Stärke, sind daher nicht mehr gut erkennbar. Bei Sternen der Spektralklasse K ist im Regelfall die Wasserstoff-Fusion beendet.
Auch die Metalllinien verlieren bei zunehmend sinkender Temperaturen zu Gunsten von Molekülbanden der Moleküle CH, CN und Titanoxid (TiO) an Stärke.
Gamma B weist eine visuelle Helligkeit von ca. 3,99 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 1,236 mag auf. Er kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 6,17 km/s auf uns zu.
In der Umlaufbahn von Gamma B Dephini wird ein Planet vermutet. Dieser könnte ca. 70% der Masse des Jupiters besitzen.
Seine Umlaufzeit beträgt ca. 525 Tagen mit einer durchschnittlichen Entfernung von ca. 1,5 AE zu Gamma B. Der endgültige Nachweis fehlt bisher. Die Daten beruhen bisher nur aufgrund von Berechnungen.
4. δ - Delta Delphini (11 Delphini, HD 197461)
Delta Delphini ist ein spektroskopisches Doppelsternsystem in einer Entfernung von 199,77 Lichtjahre mit einer Unsicherheit von + / - 3,59 Lichtjahren.
Delta A und Delta B sind rund 0,37 AE voneinander entfernt mit einer Umlaufdauer von ca. 40,58 Tagen.
Da die beiden Sterne nur anhand der Spektroskopie als Einzelsterne auflösbar sind, wird bisher angenommen, dass beide Sterne zum Teil dieselben Eigenschaften besitzen.
Sie sind die Namengeber einer bestimmten Klasse von Sternen. Die Delta Delphini-Sterne sind eine Unterklasse der Delta-Scuti-Sterne.
Die Delta-Scuti-Sterne sind pulsationsveränderliche Sterne, die Schwankungen in ihrer Leuchtkraft aufweisen. Sie besitzen zwischen ca. 1,5 bis 2,5 Sonnenmassen, die ca. 10- bis 50–fache Leuchtkraft der Sonne und werden den Spektralklassen A2 bis F8 zugeordnet.
Delta-Scuti-Sterne zeigen ihre Veränderungen in Perioden innerhalb von 0,3 Tagen mit einer Helligkeitsveränderung von max. 0,8 mag, wobei die meisten Sterne nur eine Variabilität von 0,02 mag erreichen. Sie werden in die Leuchtkraftklassen III bis V eingeordnet.
Das Doppelsternsystem Delta Delphini weist eine visuelle Helligkeit von 4,2905 mag und absolute Helligkeit von 0,355 mag auf.
Das Doppelsternsystem Delta Delphini zeigt verschiedene visuelle Helligkeitsveränderungen. Dabei verändert sich die Helligkeit des Sternensystems an 0,156, 0,136 und 0,153 Tagen um ca. 0,1 mag.
Die Klassifikation eines Delta Scuti-Sterns ist eine photometrische Klassifikation. Diese besteht im Regelfall auch für die Delta Delphini-Sterne. Darüber hinaus unterscheiden sich die Delta Delphini Sterne durch ihre spektroskopische Klassifikation.
Delta Delphini Sterne sind Metall-Linien-Sterne, bei denen ein geringer Unterschied in der Metall-Line und der K-Line-Typ (Kalzium) besteht.
Das Metalllinien-Spektrum der Delta Delphini Sterne entspricht dem eines F2IV-Sterns, wobei aber die Wasserstoff- und ionisierten Kalziumlinien sehr schmal sind.
Das Spektrum der Delta Delphin Sterne zeigt ziemlich schmale, aber gleiche H- und K-Linien.
Das metallische Linienspektrum ist reich und ähnelt dem eines späten A-Metallliniensterns (Am-Stern).
Die Am-Sterne sind eine Unterklasse der chemically peculiar stars (chemisch eigentümlich Sterne) (CP-Sterne), des Spektraltyps A, bei denen in der Atmosphäre Metalle (m) wie Zink, Strontium, Zirkonium und Barium in erhöhter Konzentration gemessen wurden. In der Astrophysik werden alle Elemente außer Wasserstoff und Helium als Metalle bezeichnet.
Dagegen zeigen die Am-Sterne einen Mangel von anderen Elementen, wie Calcium und Scandium.
Der Grund für die chemischen Anomalien ist auf einige Elemente zurückzuführen, die mehr Licht absorbieren, das heißt aufnehmen. Diese chemischen Elemente werden nach oben zur Oberfläche gedrückt wird, während andere unter der Schwerkraft absinken.
Dieser Effekt tritt nur auf, wenn der Stern eine geringe Rotationsgeschwindigkeit besitzt. Normalerweise rotieren Sterne der Spektralklasse A schnell. Die meisten Am-Sterne sind Teil eines Doppelsternsystems, in dem die Rotation der Sterne durch das sogenannte Gezeitenbremsen verlangsamt wurde. Dabei nimmt der Partnerstern Einfluss auf die Rotationsgeschwindigkeit.
Die Rotationsgeschwindigkeit von Delta A + B beträgt nur ca. 17 km/s.
Der Spektraltyp der Am-Sterne wird aus der Calcium-K-Linie (Ca-II-Linie) zensiert.
Auch Delta Delphini wird anhand der Ca-II-Linie beurteilt. Seine Spektralklasse lautet: kA7hF1VmF1pSrEuCr.
Das bedeutet:
Delta A und Delta B werden als ein A7-Stern beurteilt, wenn sie durch die Calcium-k-Linie beurteilt werden (kA7). Sie werden als ein F1V angesehen, wenn sie nach ihren Wasserstofflinien bewertet werden (hF1V).
Wenn die Delta A und Delta über die Metalllinien charakterisiert werden sind sie „peculiar (p)“ Stars der Spektralklasse F1 in dessen Spektrum erhöhte Werte der Elemente Strontium (Sr), Europium (Eu) und Chrom (Cr) gefunden wurden (mF1pSrEuCr).
Delta A besitzt die ca. 1,78-fache Masse und den ca. 3,43-fachen Radius unsere Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 7.440 Kelvin und er strahlt mit der ca. 32,4-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
Delta B besitzt die ca. 1,62-fache Masse und den ca. 3,48-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 7.110 Kelvin und er strahlt mit der ca. 28,8-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
5. η- Eta Delphini (3 Delphini, HD 195943)
Eta Delphini ist ein spektroskopisches Doppelsternsystem in einer Entfernung von 179,77 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von + / - 4,49 Lichtjahren.
In der Zeitschrift „Astronomy&Astrophysics“ wurden 2021 erstmals Daten dazu veröffentlicht.
Die Umlaufbahn ist bei einer Exzentrizität von 0,093 fast kreisrund. Die Umlaufdauer beträgt ca. 3,73 Jahre.
Eta A ist ein Stern der Spektralklasse A3IVs. Er ist sogenannter „Am“-Stern, der noch Wasserstoff zu Helium fusioniert.
Eta A besitzt die ca. 2,12-fache Masse und den ca. 2,2-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 8.884 Kelvin und er strahlt mit der ca. 30-fachen Helligkeit unserer Sonne. Er dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 65 km/s.
Eta Delphini weist eine visuelle Helligkeit von 5,379509 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 1,673 mag auf.
Er wird wie Gamma A Delphini als ein sogenannter „High Proper Motion Star“ eingestuft und kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 25 km/s auf uns zu.
Sein Begleiter besitzt etwa 54% der Masse unserer Sonne (561-fache Jupitermassen). Wahrscheinlich handelt es sich dabei um einen Roten Zwergstern.
6. Adulfin (ε – Epsilon Delphini, 2 Delphini HD 195810))
Adulfin ist ein weiß-blau leuchtender Unterriese der Spektralklasse B6IV in einer Entfernung von 359,2 Lichtjahren mit einer Unsicherheit von 22,12 Lichtjahren.
Er besitzt die ca. 4,8-fache Masse und den ca. 4,6-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 13.614 Kelvin und er strahlt mit der ca. 676-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
Adulfin befindet sich noch mitten in der Fusion von Wasserstoff zu Helium.
Er dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 52 km/s.
Adulfin kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 19,4 km/s auf uns zu.