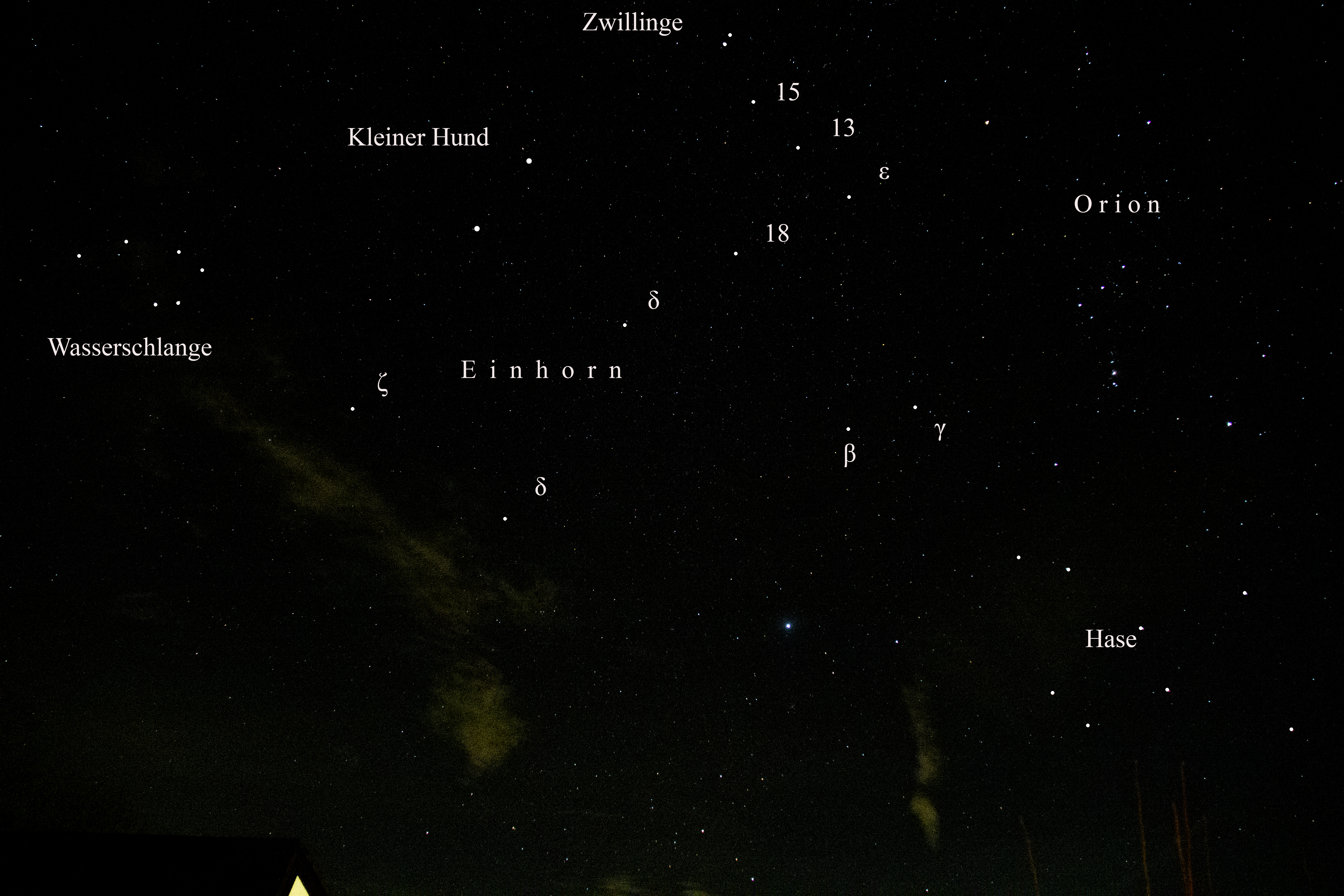1. Lukida (α – Alpha Monocerotis, 26 Monocerotis, HD 61935)
Lukida ist ein orange leuchtender Stern der Spektralklasse K0III in ca. 147,8 Lichtjahren Entfernung.
Spektralklassen werden dazu verwendet um einen Stern in einer bestimmten Gruppe zusammenzufassen, wobei in der Bezeichnung auch schon eine relativ genaue Aussage zu den Eigenschaften des Stern getroffen wird. Denn es werden weitere Unterteilungen vorgenommen.
Die Einteilung der Spektralklassen beruht bis heute auf der Basis, die im 19. Jahrhundert gelegt wurde. Zwischenzeitlich wurde das System immer mehr verfeinert, so dass anhand der Spektralklasse schon eine grobe Zusammenfassung über einen Stern möglich ist.
Lukida wird in der Spektralklasse K (lateinischer Buchstabe) verortet. In früheren Zeiten wurde angenommen, dass Sterne der Spektralklasse K am Ende ihres Sternenlebens stehen. Daher wurde die Spektralklasse K auch als „späte Klasse“ bezeichnet. Heute werden die Buchstaben nach dem Licht verteilt, dass sie aussenden.
Sterne der Spektralklasse K stehen für die orange-rote leuchtenden Sterne in einem Temperaturbereich von 3.500 bis 4.900 Kelvin. Aufgrund der nicht sehr hohen Temperaturen können Hauptreihensterne der Spektralklasse K mehr als 50 Mrd. Jahre alt werden.
Bei den kleinen Sternen der Spektralklasse K, mit ca. 50 bis 80 % der Masse unserer Sonne, wird vermutet, dass sie eventuell eine für Planeten lebensfreundlich Umgebung bieten könnten.
Allerdings sind sie aufgrund ihres geringen Energieverbrauchs und der damit verbundenen geringen Leuchtkraft nur sehr schwer zu beobachten. Im Regelfall sind die für uns sichtbaren Sterne der Spektralklasse K wie Lukida Riesensterne. Sie sind für uns nur aufgrund der stark vergrößerten Oberfläche von meist weit mehr als 10 Sonnenradien zu sehen.
Die Zahl 0 zeigt in welchem Temperaturbereich ein Stern sich befindet. Die Zahl 0 steht für die heißen Sterne, die Zahl 10 steht für die kühlen Sterne der jeweiligen Spektralklasse. Sterne der Spektralklasse K weisen Temperaturen im Bereich von 3.500 bis 4.900 Kelvin auf.
Lukida wird mit der Zahl 0 Buchstaben als ein heißerer Stern der kühlen Spektralklasse K eingestuft. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.760 Kelvin. Unsere Sonne hat eine Oberflächentemperatur von ca. 5.770 Kelvin (5.507 Grad Celsius).
Die römische Ziffer zeigt die Leuchtkraftklasse eines Sterns an.
Diese beginnen bei VII und endet bei O. O sind die heißesten und hellsten Sterne, die am Anfang ihres Sternenlebens stehen, während VII für Sterne stehen, die ihr Leben hinter sich haben. Wobei die römische Ziffer nicht die Reihenfolge eines Sternenlebens anzeigt.
Lukida wird in die Leuchtkraftklasse III eingestuft und ist damit ein Riesenstern.
Unsere Sonne ist ein Stern der Spektralklasse G2V (Zwergstern) und damit ein durchschnittlicher Hauptreihenstern in unserem Teil der Galaxis mit einem Alter von ca. 4,5 Mrd. Jahren und einer voraussichtlichen Lebensdauer von nochmals rund 8 Mrd. Jahren.
Ein Hauptreihenstern ist nicht eine Art von Stern, sondern bedeutet eine Zustandsart, in welcher der Stern seine meiste Lebenszeit verbringt. Unsere Sonne befindet sich noch mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium.
Die Umwandlung von Wasserstoff zu Helium geschieht jedoch schrittweise.
Bei unserer Sonne fusionieren im ersten Schritt zwei Protonen (zwei Wasserstoff-Kerne) zu einem Kern des schweren Wasserstoffs (Deuterium). Eigentlich dürfte eine solche Verschmelzung gar nicht vorkommen. Da im Kern des Sterns die Temperaturen und der Druck sehr hoch sind, ist es aber unvermeidlich, dass zwei Protonen miteinander fusionieren. In der Chemie und Physik wird das Verbrennen eines Stoffes als Fusion bezeichnet.
Der folgenlose Zusammenstoß von Protonen im Kern passiert dauernd. Sehr selten sind jedoch die Fusionen. Daher auch der lange Zeitraum bis Wasserstoff zu Helium wird.
Bei der Fusion der Protonen wandelt sich eines der beiden Protonen in ein Neutron um, dass im Deuterium-Kern verbleibt, sowie in ein Positron und ein Neutrino, die beide den Atomkern verlassen. Das Neutrino verlässt die Sonne als Strahlung. Die Neutrino-Strahlung erreicht auch unsere Erde, ist jedoch nur schwer nachweisbar. Das Positron zerstrahlt mit einem Elektron in zwei hochenergetische Photonen.
Im zweiten Schritt fusioniert der Deuterium-Kern ebenfalls wieder selten mit einem weiteren Proton zu einem Kern des leichten Helium-Isotops Helium-3. Dabei entsteht ein Gammaphoton außerhalb des Kerns.
Im dritten Schritt fusionieren schließlich zwei Helium-3-Kerne zu einem schweren Helium-4-Isotop. Dabei werden wieder zwei Protonen frei.
Damit wurde aus vier Protonen ein Helium-Kern. Im Rahmen der Fusionen wurde Energie in Form von hochenergetischen Photonen frei.
Bei unserer Sonne verwandeln sich so in einer Sekunde 564 Millionen Tonnen Wasserstoff in 560 Millionen Tonnen Helium. Die Masse von 4 Millionen Tonnen wird in Strahlungsenergie umgesetzt. Diese erreicht uns als Sonnenenergie und sorgt für unser Tageslicht.
Neben diesem, in drei Schritten stattfindenden Fusionsprozess, gibt es für die Fusion von Wasserstoff zu Helium noch einen weiteren Vorgang, den CNO-Zyklus.
Beim CNO-Zyklus, der nach seinen Entdeckern, den Physikern Hans Bethe und Carl Friedrich von Weizäcker auch „Bethe-Weizäcker-Zyklus“ genannt wird, werden in acht Schritten vier Wasserstoffkerne zu einem Helium-Kern fusioniert. Der Name CNO-Zyklus weist darauf hin, dass dieser Prozess unter der Verwendung von Kohlenstoff (C), Stickstoff (N) und Sauerstoff (O) stattfindet.
Ab einer Masse des 1,4- bis 1,6-fachen unserer Sonne wird über den CNO-Zyklus der größte Teil der Fusion von Wasserstoff zu Helium erfolgen.
Lukida ist schon sehr viel weiter als unsere Sonne.
Am Ende Kern-Wasserstofffusion hatte Lukida im Kern eine so hohe Dichte, dass dieser entartete. Entartung bedeutet, dass sich die Materie nicht auf herkömmliche Weise beschreiben lässt, da die Dichte so extrem groß ist. Es hat nichts mit dem klassischen idealen Gas zu tun.
Durch die hohe Dichte und Temperatur hat das Helium-Brennen begonnen. Dabei werden drei Helium-Kerne im Inneren des Sterns im Rahmen einer Kernfusion in Kohlenstoffe und Sauerstoff umgewandelt. Bei diesem Fusionsprozess wird in erhöhter Konzentration Gammastrahlung ausgesendet.
Diese Kernfusion kann nur bei Temperaturen von über 100 Mio. Kelvin stattfinden. Der Vorgang wird auch als Drei-Alpha-Prozess bezeichnet. Durch den äußerst rasch aufschaukelnden Prozess wird die Temperatur sehr schnell sehr hoch. Die explosionsartige Fusion von Helium im Drei-Alpha-Prozess wird auch Helium-Blitz genannt.
Sobald die Kerntemperatur genügend hoch ist, wird die Entartung wieder aufgehoben. Dadurch, dass das Gas wieder „normal“ wird und der herrschende Gasdruck wieder temperaturabhängig ist, kommt es zu einer heftigen Expansion des Sterns. Der Stern dehnt sich aus und sein Umfang wird größer.
Die Hülle des Sterns ist aber in der Lage den Ausbruch abzufangen. Es kommt zu keiner Explosion sondern nur zu einer Expansion des Sterns. Aber durch die Heftigkeit der Ausdehnung des Sterns werden die äußeren kühleren Schichten abgeworfen. Dadurch gelangen Materie und Gaswolken ins All, die wiederum zum Beginn von neuen Sternen werden können.
Lukida besitzt die ca. 2-fache Masse und den ca. 10-fachen Radius unserer Sonne. Er strahlt aufgrund der vergrößerten Oberflächen mit der ca. 67-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
Die Spektralklasse K ist dadurch gekennzeichnet, dass sie starke Metalllinien zeigt.
Die Spektren der Spektralklasse K zeichnen sich durch zahlreiche Absorptionslinien aus. Diese stammen meist von elementaren Metallen wie Kalzium (Ca I), Natrium (Na I) und Eisen (Fe I). Die Wasserstofflinien der Balmerserie verlieren weiter an Stärke, sind daher nicht mehr gut erkennbar.
Bei Riesensternen der Spektralklasse K ist im Regelfall die Wasserstoff-Fusion beendet. Auch die Metalllinien verlieren bei zunehmend sinkender Temperaturen zu Gunsten von Molekülbanden der Moleküle CH, CN und Titanoxid (TiO) an Stärke
Lukida wird als sogenannter „Red Clump Star“ eingestuft.
Die Red Clump Stars (Roten Klumpensterne) haben ihren Namen durch die Lage im Hertzsprung-Russel-Diagramm. Sie sind dort eine Ansammlung von Roten Riesen mit einer Temperatur im Bereich von 5.000 Kelvin und einer visuellen Helligkeit von ca. 0,5 mag (etwas mehr oder weniger). Sie treten an einer Stelle im Diagramm vermehrt auf und bilden dort einen „Klumpen“. Vielfach treten sie in Kugelsternhaufen mittleren Alters auf.
Die Red Clump Stars sind ehemalige Hauptreihensterne, die die Wasserstoff-Fusion im Kern vor langer Zeit beendet haben und mittlerweile Helium im Kern fusionieren.
Lukida dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 1,9 km/s und benötigt für eine Umdrehung etwa 326 Tagen. Unsere Sonne hat eine Drehgeschwindigkeit von ca. 2 km/s und benötigt etwa 25 Tage für eine Drehung.
Lukida weist eine visuelle Helligkeit von ca. 3,94 mag auf. Je höher der Wert ist, der in Magnituden (mag) gemessen wird, umso schwieriger kann ein Stern von uns gesehen werden. Ab einer Magnitude von mehr als ca. 6,0 ist ein Stern nur noch im Teleskop sichtbar. Die Magnitudenzahl wurde in einem logarithmischen System entwickelt, um die Lichtschwäche eines Sterns darzustellen. Unsere Sonne hat eine visuelle Helligkeit von ca. -26,7 mag.
Die absolute Helligkeit von Lukida beträgt ca. – 0,71 mag. Die absolute Helligkeit wird aus einer Entfernung von 32,6 Lichtjahren gemessen; unsere Sonne hat eine absolute Helligkeit von 4,84 mag. 32,6 Lichtjahren entsprechen 10 Parsec, eine weitere astronomische Entfernungseinheit.
Lukida entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 10,5 km/s.
2. ζ - Zeta Monocerotis (29 Monocerotis, HD 67594)
Zeta Monocerotis ist ein gelb leuchtender Überriese der Spektralklasse G2Ib in ca. 683 Lichtjahren Entfernung. Aufgrund der weiten Entfernung gibt es über seinen Entwicklungsstand nur theoretische Vermutungen.
Die Spektralklasse G steht für die weiß-gelb leuchtenden Sterne.
Im Regelfall befinden sich Sterne der Spektralklasse G in einem Temperaturbereich von 4.900 bis 6.000 Kelvin. Durch diese nicht allzu hohen Temperaturen haben Hauptreihensterne ähnlich unserer Sonne keinen großen Energieverbrauch und können mehr als 10 Mrd. Jahre alt werden.
Gelbe Riesensterne sind massereiche Sterne der Spektralklassen F und G sowie ehemalige Hauptreihensterne. Die bekannten Gelben Riesensterne weisen eine Masse von mindestens dem dreifachen unserer Sonne auf. Die größten von ihnen können die hundertfache Masse unserer Sonne besitzen.
Ihren Namen erwarben die Gelben Riesensterne durch ihr gelb-weiß strahlendes Licht, im bei uns sichtbaren Bereich. Die Gelben Riesen sind etwas kühler als die Blauen Riesen.
Im Gegensatz zu den Hauptreihensternen ist der Energieverbrauch der Gelben Riesensterne enorm. Die verschiedenen Fusionsvorgänge finden bei ihnen im Regelfall innerhalb einiger zehn Millionen Jahren statt. Unsere Sonne wird dafür rund 13 Mrd. Jahre benötigen.
Die Gelben Riesen befinden sich im Regelfall in einer sehr weit fortgeschrittenen Sternenentwicklungen. Sie stehen in astronomischen Zeiträumen gemessen kurz vor der nächsten Stufe und werden dann zu einem Roten Riesen.
Bei vielen von ihnen handelt es sich um weiterentwickelte ehemalige Blaue Riesenstern oder Hauptreihensterne.
Zeta Monocerotis befindet sich wahrscheinlich noch mitten in der Kernfusion von Helium zu Kohlenstoffen und Sauerstoff. Wie weit dieser Vorgang schon fortgeschritten ist, ist nicht bekannt.
Überriesen sind die massereichsten und leuchtkräftigsten Sterne am Nachthimmel.
Im sogenannten MK-System (benannt nach seinen Urhebern William Wilson Morgan und Philip C. Keenan vom Yerkes-Observatorium) werden die Riesensterne folgenden Leuchtkraftklassen zugeordnet:
Ib steht für die Überriesen,
Ia steht für leuchtende Überriesen und
0 oder Ia stehen für die Hyperriesen.
Ihre absolute Helligkeit liegt meist im Bereich zwischen - 3 und – 8 mag. Je nachdem in welchem Entwicklungsstadium der Stern sich befindet beträgt die Oberflächen-Temperatur zwischen 3.400 Kelvin (bei sterbenden Sternen) und mehr als 20.000 Kelvin bei Sternen, die erst am Anfang ihres Sternenlebens stehen.
Zeta Monocerotis weist eine visuelle Helligkeit von ca. 4,0437 mag auf, die vom Satelliten GAIA gemessen wurde.
Für den Astrometrie-Satelliten GAIA ist es schwierig Sterne mit einer größeren Helligkeit als 3 mag zu vermessen. Daher wurde die überwiegende Mehrheit der Sterne mit einer Helligkeit zwischen 10 und 15,5 mag im G-Band gemessen. GAIA benutzt dabei eine eigene Definition der “G-Band-Magnitude“.
Seine absolute Helligkeit liegt bei ca. – 2,56 mag. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.937 Kelvin und er strahlt mit der ca. 883-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
Aufgrund ihrer Größe besitzen die Überriesen meist eine geringere Oberflächen-Gravitation (Schwerkraft). Dadurch kommt es bei den älteren Riesensternen immer wieder zu Änderungen der Elemente in der Atmosphäre.
Die Überriesen werden über ihre Entwicklungsgeschichte definiert.
Sterne, die mit mehr als 8 - 10 Sonnenmassen mit der Kern-Wasserstofffusion beginnen, fusionieren nach der Kern-Heliumfusion weitere schwerere Elemente, bis sie einen Eisenkern entwickeln. An diesem Punkt kollabiert der Kern und wird zu einer Supernova vom Typ 2. Sobald diese massereichen Sterne die Hauptreihenphase verlassen, blähen sich ihre Atmosphären auf und sie werden als Überriesen bezeichnet.
Sterne, die bereits am Beginn ihres Sternenlebens unterhalb von 10 Sonnenmassen liegen, bilden niemals einen Eisenkern und werden in ihrer Entwicklung nicht zur Supernova, obwohl sie die tausendfache Helligkeit der Sonne erreichen können.
Zeta Monocerotis besitzt die ca. 6,2-fache Masse und den ca. 40-fachen Radius unserer Sonne. Er dreht sich mit Rotationsgeschwindigkeit von ca. 17 km/s.
Zeta Monocerotis entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 30 km/s.
Laut dem WDS-Katalog werden Zeta Monocerotis drei weitere Sterne zugeordnet.
Der Washington Double Star Catalog (WDS-Katalog) ist eine astronomische Datenbank in dem Mehrfach-Sternensysteme aufgeführt sind. Dabei kann es sich um physikalisch zusammenhängende Sterne oder nur visuell bei einander stehende Sterne handeln.
Zeta B Monocerotis (UCAC2 30845054) ist wahrscheinlich ebenfalls ein Stern der Spektralklasse G in ca. 2.513 Lichtjahren Entfernung mit dem ca. 10,5-fachen Radius unserer Sonne.
Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.900 Kelvin und er strahlt mit der ca. 57-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
UCAC2 30845054 weist eine visuelle Helligkeit, die im G-Band des Satelliten GAIA gemessen wurde, von ca. 9,85 mag und auf eine absolute Helligkeit von ca. 0,42 mag auf.
Er entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 26,5 km/s.
Zeta C Monocerotis (BD-02 2449) ist wahrscheinlich ein Riesenstern der Spektralklasse K in ca. 2.814 Lichtjahren Entfernung mit dem ca. 35-fachen Radius unserer Sonne.
Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.285 Kelvin und er strahlt mit der ca. 366-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
BD-02 2449 weist eine visuelle Helligkeit, die im G-Band des Satelliten GAIA gemessen wurde, von ca. 8,3253 mag und auf eine absolute Helligkeit von ca. -1,354 mag auf.
Über Zeta D Monocerotis ist nichts bekannt.
3. δ - Delta Monocerotis (HD 55185, 22 Monocerotis)
Delta Monocerotis ist ein Unterriese der Spektralklasse A0IV in ca. 381 Lichtjahren Entfernung.
Unterriesen sind Sterne die heller als ein normaler Hauptreihenstern strahlen, aber nicht so hell wie Riesenstern. Sie befinden sich im Regelfall am Ende der Wasserstoff-Fusion oder am Anfang der Helium-Fusion im Kern.
Im Rahmen der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium verringert sich der Wasserstoff im Kern des Sterns, gleichzeitig steigt aber die Atommasse an. Um das Temperatur- und Druckgleichgewicht aufrecht zu erhalten, kommt es zu einer Verdichtung der Masse.
Dabei gewinnt die Gravitation gegenüber dem Gasdruck die Oberhand. Das bedeutet, durch die Massenanziehung (Gravitation) verdichtet sich der Kern noch mehr. Dadurch kommt es zu einem Temperaturanstieg.
Damit wächst die nukleare Energieproduktion und durch diese erhöht sich auch die Leuchtkraft des Sterns.
Durch den Temperaturanstieg wegen der Verdichtung im Kern setzt jetzt in der bisher inaktiven Wasserstoffhülle des Sterns die Kernfusion ein. Auch hier wird jetzt der Wasserstoff zu Helium fusioniert.
Das Verbrennen des Wasserstoffs vom Kern zur Hülle wird Wasserstoff-Schalenbrennen genannt (wie die Schalen einer Zwiebel). Dadurch wird die Hülle des Sterns größer. Damit ist der Stern im Stadium eines Unterriesen
Delta Monocerotis befindet sich wahrscheinlich am Ende der Kern-Wasserstoff-Fusion zu Helium.
Sterne der Spektralklasse A stehen für weiß leuchtende Sterne. Diese Sterne weisen Oberflächen-Temperaturen im Bereich von 7.400 bis 10.000 Kelvin auf. Bei diesen Sternen erfolgt die Kernwasserstoff-Fusion zum größten Teil durch den CNO-Zyklus.
Aufgrund der hohen Temperaturen besitzen sie eine hohe Leuchtkraft und können daher gut am Nachthimmel beobachtet werden.
Die Oberflächen-Temperatur von Delta Monocerotis beträgt ca. 8.340 Kelvin und er strahlt mit der ca. 300-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
Er besitzt die ca. 3,5-fache Masse und den ca. 4-fachen Radius unserer Sonne.
Delta Monocerotis weist eine im G-Band des GAIA-Satelliten gemessene visuelle Helligkeit von ca. 4,0405 mag und auf eine absolute Helligkeit von ca. – 1,30 mag auf. Er entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 15 km/s.
4. β - Beta Monocerotis (11Monocerotis)
Beta Monocerotis ist ein Mehrfach-Sternensystem in ca. 625 Lichtjahren Entfernung.
Beta A und das Mehrfach-Sternsystem Beta BC sind ca. 1.570 AE von einander entfernt und weisen eine Umlaufzeit von ca. 14.000 Jahren auf. Eine Astronomische Einheit (AE) ist die durchschnittliche Entfernung von der Sonne zur Erde. Diese beträgt ca. 149,6 Mio. km.
Im Mehrfachsternen-Sternsystem Beta BC umkreisen sich das Doppelsternsystem Beta B und der Stern Beta C in einer Entfernung von ca. 590 AE mit einer Umlaufzeit von ca. 4.200 Jahren
Beta B könnte ein Doppelsternsystem sein. Bisher ist sich die Fachwelt hier noch uneins.
Aufgrund der weiten Entfernung gibt es nur wenige Erkenntnisse über das Sternensystem.
Beta Monocerotis entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von 17,2 km/s.
4.1 Beta A Monocerotis (HD 45725)
Beta A (HD 45725) ist ein Stern der Spektralklasse B4Veshell. Er ist ein sogenannter „Be-Star“, der wahrscheinlich von eine Hülle („shell“) und einer Scheibe umgeben ist.
Sterne der Spektralklasse B sind sehr heiße Sterne, da sie ihren Wasserstoff sehr schnell fusionieren. Sie sind zwar selten, aufgrund ihrer Leuchtkraft werden aber ein Drittel der hellsten Sterne am Nachthimmel der Spektralklasse B zugerechnet.
Den größten Teil ihrer Strahlung senden sie aufgrund ihrer hohen Temperatur im ultravioletten Bereich aus. Diese hochenergetische Strahlung reicht ab der Spektralklasse B2 (bei einer Oberflächen-Temperatur von mehr als 20.000 Kelvin) aus, um das Leuchten von Emissionsnebeln anzuregen.
Die Oberflächen-Temperatur von Beta A beträgt ca. 18.070 Kelvin und er strahlt mit der ca. 3.200-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
Be-Stars sind im Regelfall Sterne der Spektralklasse B in deren Spektrum Emissionen (e) der sogenannten „Balmer-Emissionslinien“ gemessen wurde. Die Balmer-Emissionslinien sind eine bestimmte Folge von Spektrallinien des Wasserstoffs (H) im sichtbaren elektromagnetischen Spektrum. Die Emissionslinie mit der größten Wellenlänge wird als Hα (H Alpha) bezeichnet. Hβ, Hγ und Hδ sind dann jeweils mit einer kleineren Wellenlänge sichtbar.
Die Emissionslinien zeigen an, dass die Be-Sterne von einer Scheibe oder Hülle aus Staub und Material umgeben sind. Das Material stammt vom Stern selbst, dass dieser durch seine schnelle Rotation an die Umgebung abgibt.
Beta A dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 345 km/s und einer Drehdauer von etwa 14 Tagen. Aufgrund der hohen Drehgeschwindigkeit ist Beta A keine Kugel sondern er sieht aus wie ein Ei.
Die Scheibe um Beta A dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von etwa 441 km/s.
Beta A befindet sich mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium. Er besitzt die ca. 8,7-fache Masse und den ca. 5-fachen Radius unserer Sonne.
Beta A weist eine visuelle Helligkeit von ca. 4,60 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 2,82 mag auf.
Das Alter von Beta A wird auf etwa 28 Mio. Jahre geschätzt.
4.2 Beta B Monocerotis (HD 45726)
Beta B (HD 45726) ist ebenfalls ein „Be-star“ mit der Spektralklasse B2Vn(e) und wird von einer Scheibe aus Gas und Staub umgeben. Auch er befindet sich noch mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium.
Beta B besitzt die ca. 6,2-fache Masse und die ca. 1.600-fache Leuchtkraft. Er dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 123 km/s.
Die Zahl 2 steht für einen heißen Sterne im Bereich von rund 20.000 Kelvin. Beta B zeigt die ca. 1.600-fache Leuchtkraft unserer Sonne. Er dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von etwa 123 km/s.
4.3 Beta C Monocerotis (HD 45727)
Beta C Monocerotis ist ein weiß leuchtender Stern der Spektralklasse B3V:nne. Er ist ebenfalls ein Be-Star. Die Präfixe „nn“ (nebulous) zeigen an, dass Beta C diffuse Spektrallinien aufweist.
Diffuse Spektrallinien bedeuten, dass sie nicht genau zu bestimmen sind. Ein Grund ist dabei eine hohe Drehgeschwindigkeit des Sterns.
Auch bei Beta B sind die Spektrallinien nicht eindeutig zu erkennen. (n). Doch bei Beta C sind die Spektrallinien noch schwieriger zu erkennen.
Die Buchstaben nn deuten auf eine sehr hohe Rotationsgeschwindigkeit hin. Beta C dreht sich mit einer Drehgeschwindigkeit von ca. 331 km/s.
Er befindet sich ebenfalls in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium und besitzt die ca. 6-fache Masse unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur dürfte im Bereich von 17.000 Kelvin liegen und er strahlt mit der ca. 1.300-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
Beta C weist eine visuelle Helligkeit, die im G-Band des GAIA-Satelliten gemessen wurde, von ca. 5,3821 mag und eine absolute Helligkeit von ca. – 1,03 mag auf.
5. γ -Gamma Monocerotis (5 Monocerotis, HD 43232)
Gamma Monocerotis ist wahrscheinlich ein Doppelsternsystem in ca. 439 Lichtjahren Entfernung.
Gamma Monocerotis wird als ein sogenannter „Bariumstern“ der Spektralklasse K1.5IIIBa0.3 eingestuft.
Barium-Sterne werden im Regelfall der Leuchtkraftklasse der Riesensterne und den Spektralklassen G bis K zu geordnet. Fast alle Barium-Sterne kommen in sehr engen Doppelsternsystemen vor, bei denen ein Transfer von Masse stattfindet (wechselwirkendes Doppelsternsystem). Wir sehen heute nur noch das Ergebnis.
Bisher wurde der Begleiter von Gamma A noch nicht entdeckt. Es wird aber davon ausgegangen, dass es ihn geben muss.
Vor langer Zeit wurde auf den jetzigen Riesen-Barium-Stern Masse seines Partners übertragen, als sich der Barium-Stern noch in der Entwicklungsphase eines Hauptreihensterns befand.
Der heute kleinere Stern im Doppelsternsystem war der Spenderstern. Zu diesem Zeitpunkt war er ein riesiger Kohlenstoffstern, der im Hertzsprung-Russel-Diagramm (HRD) dem asymptotischen Riesenast (AGB: Asymptotic Giant Branch) zuzuordnen wäre.
In diesem Teil des HDR befinden sich die kühlen Riesensterne, die am Ende ihres Sternenlebens angelangt sind.
Bei diesen Riesensternen läuft im Regelfall auch der sogenannte „s-Prozess“ (s = slow, langsam) ab. Dieser findet bei einer niedrigen Neutronendichte und relativ niedrigen Temperaturen des Sterns statt. Sterne, die sich in diesem Stadium befinden, fusionieren alle uns bekannten Elemente bis zu einer Massenzahl von A = 210.
Der s-Prozess läuft hauptsächlich in Sternen ab, in deren Kern das Wasserstoff- und Helium-Brennen bereits zum Erliegen gekommen ist und in denen durch Schalenbrennen in einer Schale um den Kern Helium zu Kohlenstoff fusioniert wird.
Barium-Sterne zeigen nun bei Messungen in ihrer Atmosphäre einen höheren Anteil an diesen „s-Prozess-Elementen“ sowie auch von Barium. Dabei handelt es sich um einfach ionisiertes Barium (Ba II), dass bei einer Wellenlänge von λ = 455,4 nm gefunden wird.
Diese Fusionsprodukte gelangten dann vom Spenderstern im Rahmen der Konvektion in die oberen Bereiche seiner Atmosphäre. Konvektion bedeutet, dass im Rahmen von Austausch und Vermischung der einzelnen Schichten im Stern die s-Prozess-Elemente langsam vom Inneren des Sterns nach außen zur Oberfläche vordringen.
Wie dann der Übergang der Elemente und eines Großteils der Masse von Gamma B auf Gamma A erfolgte, ist noch nicht ganz geklärt, da dieser Übertragungsprozess bei den Barium-Sternen noch nicht vollständig analysiert ist.
Am Ende des Prozesses hat sich dann Gamma B von einem Riesenstern zu einem Weißen Zwerg entwickelt.
Ein Weißer Zwerg ist ein Stern, bei dem keine Kernfusion mehr stattfindet. Er ist das Endstadium eines Sterns, der eine zu geringe Masse besaß um nach einem Supernova-Ausbruch als Neutronenstern oder einem Schwarzen Loch zu enden.
Weiße Zwerge befanden sich am Ende ihres Sternenlebens unterhalb der sogenannten Chandrasekhar-Grenze (benannt nach dem indischen Physiker Subrahmanyan Chandrasekhar) mit einer Restmasse von weniger als 1,44 Sonnenmassen.
Im Regelfall bestehen Weiße Zwerge aus einem Kern aus heißer entarteter Materie von extrem hoher Dichte. Diese wird von einer dünnen, leuchtenden Photosphäre umhüllt.
Ein Weißer Zwerg, der die Masse unserer Sonne besitzt, weist nur die Größe des ein- bis zweifachen unserer Erde auf. Sie können eine Oberflächen-Temperatur von mehr als 50.000 Kelvin besitzen. Aufgrund ihrer geringen Größe sind sie jedoch sehr leuchtschwach.
Die Weißen Zwerge sind in der Klasse D (für Degeneriert ) verortet, da in ihnen keine Kernfusionen mehr stattfinden und sie langsam abkühlen.
Im Regelfall stehen die beiden Sterne im Doppelsternsystem stehen so nah beieinander, dass sie sich an der sogenannten „Roche-Grenze“ befinden (benannt nach Edouard Albert Roche). Bis zur Roche-Grenze hat ein Stern, der einen anderen Stern umkreist, eine innere Stabilität, die den Stern zusammenhält. Je näher sich zwei Sterne an dieser Grenze aufhalten, umso größer ist ihre gegenseitige Beeinflussung. Das kann bis dazu führen, dass der kleinere Himmelskörper verformt oder sogar zerstört wird.
Bei uns ist das Doppelsternsystem in einen Zeitpunkt zu sehen, bei dem der Spenderstern Gamma B schon lange ein Weißer Zwerg ist und der Barium-Stern Gamma A sich zu einem Roten Riesen entwickelt hat.
Am Ende des bisher stattgefundenen Prozesses haben wir dann im Sternensystem Gamma Monocerotis einen Riesenstern der Spektralklasse K1.5IIIBa0.3 und einen Weißen Zwergstern.
Gamma A wird als sogenannter milder Barium-Stern eingestuft.
Bei einem milden Barium-Stern wurde weniger Barium in der Atmosphäre gefunden als bei den Barium-Sternen sonst üblich.
Der Grund für das geringere Barium in der Atomsphäre ist nicht bekannt. Allerdings gibt es verschiedene Theorien für die unterschiedlichen Bariumwerte in den Barium-Sternen:
- Während des ersten dregde-Up (in der RGB-Phase) kommt es zu einer unterschiedlichen Verdünnung der Atmosphäre
Bei einem Stern können drei sogenannte „Dregde-Up“ vorkommen.
Bei einem dregde up werden die gesamten Schichten eines Sterns durcheinandergewirbelt. Denn der Stern bildet hier eine einzige Konvektionszone. Im Regelfall findet in den einzelnen Konvektionszonen ein Austausch der einzelnen Schichten im Rahmen der Wärmeübertragung statt.
Der erste dregde up beginnt, wenn ein Stern seine Hauptreihen-Phase verlässt und sich zu einen Roten Riesen weiterentwickelt.
Der zweite dredge up findet bei Sternen statt die zwischen 4 und 8 Sonnenmassen besitzen, wenn die Kern-Heliumfusion beendet wird.
Der dritte dregde up beginnt, wenn der Helium-Blitz in der äußeren Helium-Hülle stattfindet.
- Die unterschiedlichen Barium-Werte können auch im Rahmen des dritten dregde up auftreten, da auch hier im Stern eine Vermischung der unterschiedlichen Elemente auftritt.
- Als eine weitere Möglichkeit werden die unterschiedlichen Masseverhältnisse des heutigen Weissen Zwergs während seiner AGB-Zeit angesehen.
Gamma A besitzt die ca. 4,5-fache Masse und den ca. 57,35-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.135 Kelvin und er strahlt mit der ca. 865-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
Gamma A dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 4 km/s.
Das Doppelsternsystem Gamma A Monocerotis weist eine visuelle Helligkeit von ca. 3,96 mag und eine absolute Helligkeit von ca. – 1,93 mag auf. Es kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 4,8 km/s auf uns zu.
Laut dem WDS-Katalog werden Gamma Monocerotis noch zwei weitere Sterne zugerechnet.
Die beiden Sterne Gamma B und Gamma C mit einer visuellen Helligkeit von ca. 13,10 und 13,6 mag stehen nur visuell in der Nähe von Gamma A.
6. 18 Monocerotis (HD49293)
HD 49293 ist ein spektroskopisches Doppelsternsystem in ca. 403 Lichtjahren Entfernung.
In spektroskopischen Doppelsternsystem stehen die beiden Sterne so nahe beieinander, dass es nicht möglich ist diese im Teleskop als zwei Sterne aufzulösen. Nur durch ihre Spektrallinien (unterschiedliche Wellenlängen des sichtbaren Lichts) können sie getrennt werden.
Über die Entfernung der beiden Sterne HD 49293A und HD 49293B zu einander ist nichts bekannt. Sie haben eine Umlaufzeit von rund 1.761 Tagen.
Das Doppelsternsystem weist eine visuelle Helligkeit, die im G-Band des GAIA-Satelliten gemessen wurde, von ca. 4,11 mag und eine absolute Helligkeit von ca. – 1,35 mag auf. Es kommt mit eine Radialgeschwindigkeit von ca. 11,29 km/s auf uns zu.
HD 49293A ist wie Gamma Monocerotis ein milder Bariumstern der Spektralklasse K0IIIaBa0.2.
Barium-Sterne bestehen aus einem sehr engen Doppelsternsystem bei dem der eine Stern auf den anderen Stern Masse übertragen hat. Über den Stern HD 49293B ist nichts bekannt. Im Regelfall handelt es bei diesen Sternen um Weiße Zwergsterne.
HD 49293A besitzt den ca. 27-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.670 Kelvin und er strahlt aufgrund der vergrößerten Fläche mit der ca. 311-fache Leuchtkraft unserer Sonne. Er dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit beträgt ca. 2 km/s.
7. ε - Epsilon Monocerotis (8 Monocerotis)
Epsilon Monocerotis ist Doppelsternsystem in ca. 134 Lichtjahren Entfernung.
Epsilon A ist wie HD 49293 ein spektroskopisches Doppelsternsystem. Epsilon Aa und Epsilon Ab sind dabei ca. 1,49 AE entfernt mit einer Umlaufzeit von etwa 331 Tagen.
Epsilon A weist eine visuelle Helligkeit, die im G-Band des GAIA-Satelliten gemessen wurde, von ca. 4,3181 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 1,245 mag auf.
Bis vor kurzem wurden Epsilon A und B ebenfalls als ein Sternensystem angesehen mit einem Abstand von rund 500 AE.
Im Rahmen der GAIA-Mission wurden die Entfernungen von Epsilon A und B neu vermessen. Dabei wurde von Epsilon A eine mittlere Entfernung von etwa 134,3133 Lichtjahren gemessen mit einer Abweichung von ca. 2,3923 Lichtjahren.
Bei Epsilon B beträgt die mittlere Entfernung ca. 130,4014 Lichtjahre mit einer Abweichung von etwa 0,2632 Lichtjahren.
Der Stern Epsilon C steht nur visuell in der Nähe von Epsilon A und B.
7.1 Epsilon A Monocerotis (HD 44769)
Epsilon Aa ist eine Hauptreihenstern der Spektralklasse A8Vn und befindet sich noch mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium.
Er besitzt die ca. 2,04-fache Masse und den ca. 2,77-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 7.670 Kelvin und er strahlt mit der ca. 23,88-fachen Leuchtkraft unserer Sonne. Der Buchstabe „n“ zeigt eine hohe Rotationsgeschwindigkeit an. Diese beträgt ca. 149 km/s.
Epsilon Aa weist eine visuelle Helligkeit von ca. 4,39 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 1,52 mag auf.
In einem in 2019 veröffentlichten Artikel in „Astronomy and Astrophysics“ der Autoren Pierre Kervella und anderer („Stellar and substellar companions of nearby stars from Gaia DR2“) wurden einige Angaben über Epsilon Ab gemacht.
Er ist wahrscheinlich ein Stern der Spektralklasse G6V mit etwa 98% der Masse und 84% des Radius unserer Sonne. Die Oberflächen-Temperatur liegt im Bereich von ca. 5.500 Kelvin.
7.2 Epsilon B Monocerotis (HD 44770)
Epsilon B Monocerotis ist ein Hauptreihenstern der Spektralklasse F5V in einer Entfernung von etwa 130,5 Lichtjahren Entfernung.
Die Sterne der Spektralklasse F befinden sich zwischen den heißen Sternen (Spektralklassen O, B, A) und den kühleren Sternen (Spektralklasse G, K M). Anhand dieser Einteilung stellen diese Sterne einen Durchschnittsstern dar.
Ihre durchschnittliche Temperatur soll im Bereich von rund 7.000 Kelvin liegen. Dadurch zeigen sie keinen allzu hohen Energieverbrauch ihres Sternenmaterials. Das wiederum führt dann zu einer durchschnittlichen Leuchtkraft.
Die Oberflächen-Temperatur von Epsilon B beträgt ca. 4.664 Kelvin und er strahlt mit der ca. 2,75-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
Während bei den Sternen der Klassen O, B und A im Rahmen des sogenannten „CNO-Zyklus“ der größte Teil des Wasserstoffs in Helium umwandeln wird, erfolgt dies bei den Sternen der Spektralklassen Klassen F und G (unsere Sonne ist ein Stern der Spektralklasse G2V) im Rahmen der vier Schritte durch die sogenannte „Proton-Proton-Reaktion“.
Epsilon B besitzt die ca. 1,6-fache Masse und den ca. 1,33-fachen Radius unserer Sonne. Er dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von rund 25 km/s.
Epsilon B weist eine visuelle Helligkeit, die im G-Band des GAIA-Satelliten gemessen wurde, von ca. 6,57 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 3,58 mag auf.
7.2 Epsilon C Monocerotis (UCAC2 33358916)
UCAC2 33358916 ist wahrscheinlich ein Stern der Spektralklasse F in ca. 6.270 Lichtjahren Entfernung mit einer Abweichung von +/- 485 Lichtjahren. Er besitzt den ca. 3,71-fachen Radius unserer Sonne.
Die Oberflächen-Temperatur von UCAC2 33358916 beträgt ca. 6.537 Kelvin und er strahlt mit etwa der 22,7-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
UCAC2 33358916 weist eine visuelle Helligkeit, die im G-Band des GAIA-Satelliten gemessen wurde, von 12,6862 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 1,27 mag auf.
8. 13 Monocerotis (HD 46300)
HD 46300 ist ein Stern der Spektralklasse A0Ib in etwa 2.550 Entfernung und wird als Überriese mit schwächerer Leuchtkraft eingestuft (Ib).
HD 46300 besitzt die ca. 12-fache Masse und den ca. 34-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. rund 10.000 Kelvin
HD 46300 weist eine visuelle Helligkeit von ca. 4,498 mag und eine absolute Helligkeit von ca. – 4,8 mag auf. Er gilt als leicht variabel mit einer Helligkeitsveränderung von 0,04 mag. Das Alter von HD 46300 wird auf etwa 16. Mio. Jahre geschätzt.
HD 46300 liegt innerhalb des Reflexionsnebels “Van den Bergh 81” (VdB 81).
Ein Reflexionsnebel ist eine interstellare Staubwolke, die von einem benachbarten Stern beleuchtet wird. Ohne den hellen Stern wäre diese Molekül-Wolke nicht zu sehen und wäre nur ein dunkler Fleck am Nachthimmel. Die Staubwolken bestehen aus zum Teil mikroskopisch kleinen Teilchen, Gas und Plasma.
Ein Grund für die Helligkeit der Reflexionsnebel liegt darin, dass die Staubkörner das Licht des Sterns sehr gut wieder zurückwerfen („reflektieren“). Zur Zeit wird davon ausgegangen, dass die Staubwolken bis zu 70% der Lichts reflektieren.
HD 46300 ist ein Teil der „Monoceros OB 1 Molecular Cloud“ (Mon OB1). Mon OB1 ist eine riesige Sternen-Entwicklungsregion in ca. 2.480 Lichtjahren Entfernung.
9. S Monocerotis (15 Monocerotis, HD 47839)
S Monocerotis (S Mon.) ist wahrscheinlich ein Mehrfach-Sternensystem.
Die genaue Entfernung ist nicht bekannt. Die letzte Berechnung aus dem Jahr 2009 beträgt rund 1.986 Lichtjahre mit einer Abweichung von + / - 238 Lichtjahren.
S Monocerotis A ist ein spektroskopisches Doppel-Sternensystem.
Die Umlaufzeit von S Monocerotis Aa und Ab beträgt 108 Jahre + / - 16 Jahre. Die Umlaufbahn folgt dabei keinem Kreis sondern eine Ellipse mit einer Exzentrizität von 0,76. Dabei sind die beiden Sterne zwischen ca. 6 und 46 AE von einander entfernt.
Das Doppelsternsystem S Mon. A ist von dem Stern S Mon B zwischen 103 und 2.200 AE entfernt.
Das Mehrfach-Sternensystem entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 22 km/s.
Laut dem WDS-Katalog werden S Moncerotis insgesamt 17 Sterne zugerechnet.
Das Mehrfach-Sternensystem ist Teil des Offenen Sternhaufens NGC 2264, bekannt auch als der „Weihnachtsbaum“. Laut dem SIMBAD-Katalog werden den Sternhaufen insgesamt 2.290 Sterne zugerechnet.
S Monocerotis Aa ist ein Blauer Riesenstern der Spektralklasse O7V((f))var.
Die Sterne der Spektralklasse O gelten als die größten, heißesten und auch massereichsten Sterne. Die Oberflächentemperatur beträgt bei den O-Sternen mindestens 28.000 Kelvin. Dadurch zeigen sie eine Leuchtkraft des bis zu 1 Mio.-fachen unserer Sonne. Aufgrund der großen Masse und den schnellen Fusions-Prozessen besitzen die O-Sterne eine nur sehr kurze Lebensdauer.
Die Oberflächen-Temperatur von S Monocerotis Aa beträgt ca. 38.500 Kelvin und er strahlt mit der ca. 214.000 Leuchtkraft unserer Sonne.
Er besitzt die ca. 29,1-fache Masse und den ca. 9,9-fachen Radius unserer Sonne.
Bei den Sternen der Spektralklasse O tritt das Problem auf, dass es ohne die Emissionslinien nicht möglich ist eine vernünftige Klassifikation zu erreichen.
Sterne der Spektralklasse „Oe“ zeigen Wasserstoff-Emissionen, während Sterne der Spektralklasse „Of“ auf Emissionen des einfach ionisieren Heliums (He II) hinweisen. Wobei auch hier noch weitere Abstufungen vorgenommen werden.
Sehr gut wird die Einteilung der Spektralklassen im Standardbuch von James B. Kaler beschrieben („Sterne und ihre Spektren“).
Aufgrund der hohen Temperaturen und der sehr hohen Leuchtkraft haben sich die Wasserstoff-Linien als ungeeignet herausgestellt. Über diese Wellenlängen wird bei den anderen Sternen die Helligkeit und auch ihre Leuchtkraft bestimmt. Bei den heißen O-Sternen wird daher die Leuchtkraft über die He II-Linien bei einer Wellenlänge von λ = 4686 gemessen.
Doch auch hier gibt nochmals drei Unterklassen der Leuchtkraft.
Die Bezeichnungen lautet hier „O((f))“, „O(f)“ und „Of“ wobei Of die hellste Leuchtkraft-Klasse darstellt.
Die Bezeichnung „((f))“ steht für Sterne mit Emissionen von zweifach-ionisiertem Stickstoff (NIII) und einer Absorption des einfach ionisierten Heliums (He II), die bei der Wellenlänge λ = 4686 sichtbar wird. Je höher die Temperatur eines Sternes umso stärker werden He II-Linien sichtbar.
S Monocerotis Aa wird in die Spektralklasse O7V((f))var eingestuft. Dabei zeigt er eine Helligkeitsveränderung von 0,04 mag.
Er weist eine durchschnittliche visuelle Helligkeit, die im G-Band des GAIA-Satelliten gemessen wurde, von 4,5096 mag und eine absolute Helligkeit von ca. – 4,41 mag auf.
Sterne der Spektralklasse O sind sehr selten, da sie astronomisch gesehen eine sehr kurze Lebenszeit besitzen. Und doch sind sie für die Entwicklung von Galaxien sehr wichtig, da sie die Galaxien mit neuem interstellarem Gas versorgen, dass für neue Sternenbildung notwendig ist.
S Monocerotis Aa dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 120 km/s.
Über S Monocerotis Ab ist aufgrund seiner Nähe nicht viel bekannt. Er wird als ein Stern der Spektralklasse B1Vn eingestuft.
Er weist eine visuelle Helligkeit von ca. 5,90 mag und eine absolute Helligkeit von ca. – 3,02 mag auf.
Auch er besitzt wahrscheinlich mehr als die 20-fache Masse unserer Sonne.
S Monocerotis B ist wahrscheinlich ein Stern der Spektralklasse B. Seine visuelle Helligkeit beträgt 7,9620 mag und seine absolute Helligkeit – 0,96 mag.