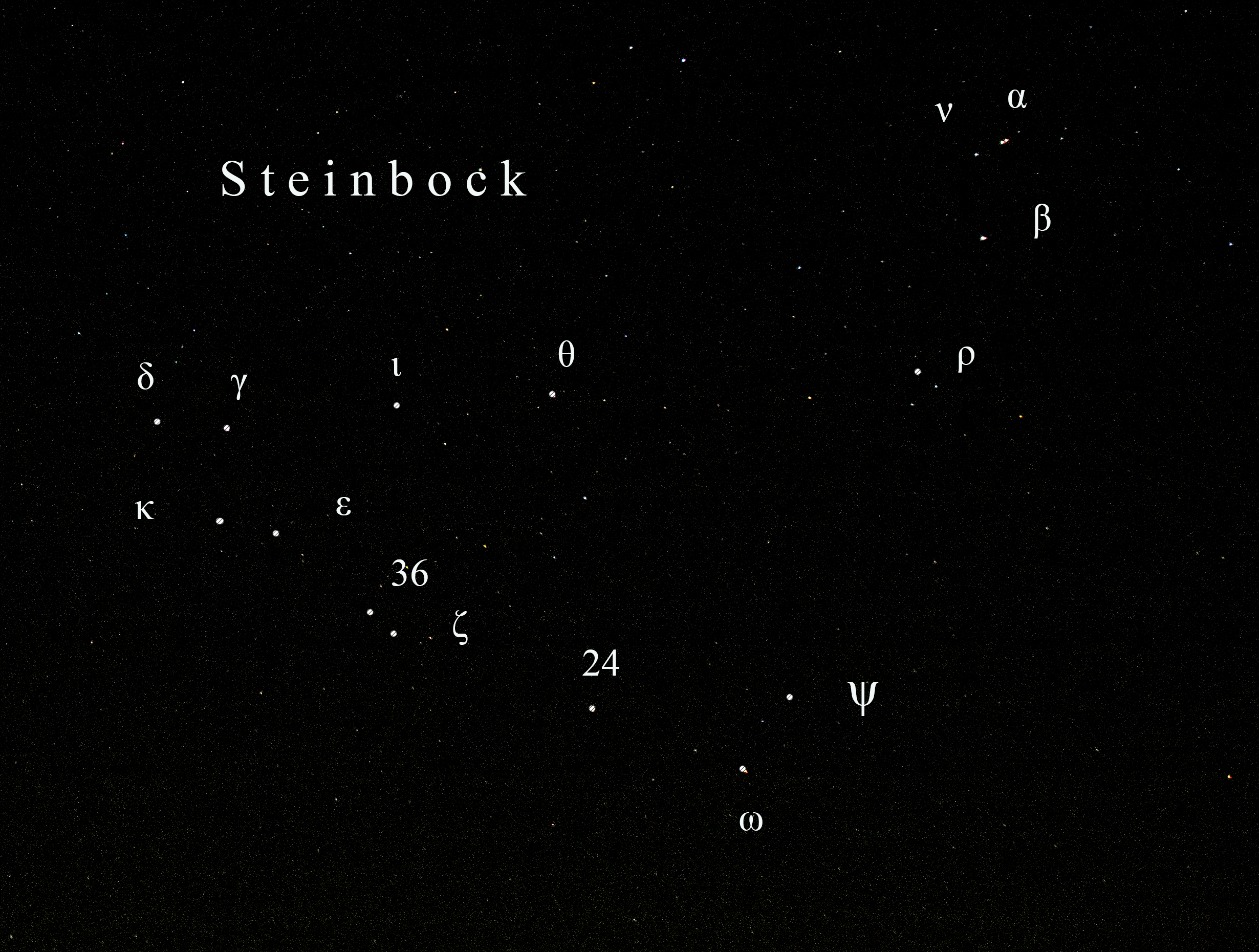1. α - Alpha Capricorni
Alpha Capricorni ist nur visuell ein Doppelsternsystem. Die beiden Lichtpunkte stehen zwar in einer Sichtlinie, sind aber so weit von einander entfernt, dass sie in keinem physischen Zusammenhang stehen. Alpha1 und Alpha2 sind jeweils Mehrfachsternensysteme.
1.1 Prima Giedi (α1 – Alpha1 Capricorni, 5 Capricorni, HD 192876)
Prima Giedi ist eventuell ein Mehrfach-Sternensystem in ca. 870 Lichtjahren Entfernung.
Alpha1 Aa und Ab sind ein visuell nicht auflösbares Doppelsternsystem, da sie zu nahe beieinander stehen. Wie weit die beiden Sterne voneinander entfernt sind und welche Umlaufzeit sie besitzen ist nicht bekannt.
Ob die Alpha B, C und D mit dem visuellen Doppelsternsystem in einer Verbindung stehen oder sich nur in derselben Sichtlinie befinden ist bisher ebenfalls noch nicht geklärt.
Alpha1 Aa ist ein gelb leuchtender Gelder Überriese der Spektralklasse G3Ib.
Spektralklassen werden dazu verwendet um einen Stern in einer bestimmten Gruppe zusammenzufassen, wobei in der Bezeichnung auch schon eine relativ genaue Aussage zu dem Stern getroffen wird. Denn es werden weitere Unterteilungen vorgenommen.
Die Einteilung der Spektralklasse beruht bis heute auf der Basis, die im 19. Jahrhundert gelegt wurde. Zwischenzeitlich wurde das System immer mehr verfeinert, so dass anhand der Spektralklasse schon eine grobe Zusammenfassung über einen Stern möglich ist.
Alpha1 Aa wird in der Spektralklasse G (lateinischer Buchstabe) verortet. In früheren Zeiten wurde angenommen, dass Sterne der Spektralklasse G in der Mitte ihrer Entwicklung stehen. Daher wurde die Spektralklasse G auch als „mittlere Klasse“ bezeichnet. Heute werden die Buchstaben nach dem Licht verteilt, dass die Sterne aussenden. Der Buchstabe G steht für die gelb leuchtenden Sterne.
Die Zahl 3 zeigt in welchem Temperaturbereich ein Stern sich befindet. Die Zahl 0 steht für die heißen Sterne, die Zahl 10 steht für die kühlen Sterne, der jeweiligen Spektralklasse.
Sterne der Spektralklasse G weisen Temperaturen im Bereich von 4.900 bis 6.000 Kelvin auf. Aufgrund der nicht allzu hohen Temperaturen besitzen sie eine niedrige Leuchtkraft. Da sie nicht allzu viel Material fusionieren müssen um diese Temperaturen dauerhaft zu erreichen, können die Sterne 10 Mrd. Jahre oder älter werden.
Alpha1 Aa wurde bisher mit der Zahl 3 und einer Oberflächen-Temperatur von ca. 5.250 Kelvin als ein sehr warmer Stern der Spektralklasse G eingestuft. Unsere Sonne hat eine Oberflächentemperatur von ca. 5.770 Kelvin (5.507 Grad Celsius). Nach den Daten des neueren GAIADR2-Katalogs beträgt die Oberflächen-Temperatur nur rund 4.700 Kelvin.
Die römische Ziffer zeigt die Leuchtkraftklasse eines Sterns an.
Diese beginnen bei VII und endet bei O. O sind die heißesten und hellsten Sterne, die am Anfang ihres Sternenlebens stehen, während VII für Sterne stehen, die ihr Leben hinter sich haben. Wobei die römische Ziffer heute nicht mehr die Reihenfolge eines Sternenlebens anzeigt.
Alpha1 Aa wird in die Leuchtkraftklasse Ib eingestuft und ist damit ein Überriese.
Unsere Sonne ist ein Stern der Spektralklasse G2V (Zwergstern) und damit ein durchschnittlicher Hauptreihenstern in unserem Teil der Galaxis mit einem Alter von ca. 4,5 Mrd. Jahren und einer voraussichtlichen Lebensdauer von nochmals rund 8 Mrd. Jahren. Ein Hauptreihenstern ist nicht eine Art von Stern, sondern bedeutet eine Zustandsart, in welcher der Stern seine meiste Lebenszeit verbringt.
Unsere Sonne befindet sich noch mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium. In der Chemie und der Physik wird das Verbrennen eines Stoffs als Fusion bezeichnet.
Die Umwandlung von Wasserstoff zu Helium geschieht jedoch schrittweise.
Bei unserer Sonne fusionieren im ersten Schritt zwei Protonen (zwei Wasserstoff-Kerne) zu einem Kern des schweren Wasserstoffs (Deuterium). Eigentlich dürfte eine solche Verschmelzung gar nicht vorkommen. Da im Kern des Sterns die Temperaturen und der Druck sehr hoch sind, ist es aber unvermeidlich das zwei Protonen miteinander fusionieren.
Der folgenlose Zusammenstoß von Protonen im Kern passiert dauernd. Sehr selten sind jedoch die Fusionen. Daher auch der lange Zeitraum bis Wasserstoff zu Helium wird.
Bei der Fusion der Protonen wandelt sich eines der beiden Protonen in ein Neutron um, dass im Deuterium-Kern verbleibt, sowie in ein Positron und ein Neutrino, die beide den Atomkern verlassen. Das Neutrino verlässt die Sonne als Strahlung. Das Positron zerstrahlt mit einem Elektron in zwei hochenergetische Photonen.
Im zweiten Schritt fusioniert der Deuterium-Kern ebenfalls wieder selten mit einem weiteren Proton zu einem Kern des leichten Helium-Isotops Helium-3. Dabei entsteht ein Gammaphoton außerhalb des Kerns.
Im dritten Schritt fusionieren schließlich zwei Helium-3-Kerne zu einem schweren Helium-4-Isotop. Dabei werden wieder zwei Protonen frei.
Damit wurde aus vier Protonen ein Helium-Kern. Dabei wurde Energie in Form von hochenergetischen Photonen frei.
Bei unserer Sonne verwandeln sich so in einer Sekunde 564 Millionen Tonnen Wasserstoff in 560 Millionen Tonnen Helium. Die Masse von 4 Millionen Tonnen wird in Strahlungsenergie umgesetzt.
Neben diesem, in drei Schritten stattfindenden Fusionsprozess, gibt es für die Fusion von Wasserstoff zu Helium noch einen weiteren Vorgang, den CNO-Zyklus.
Beim CNO-Zyklus, der nach seinen Entdeckern, den Physikern Hans Bethe und Carl Friedrich von Weizäcker auch „Bethe-Weizäcker-Zyklus“ genannt wird, werden in acht Schritten vier Wasserstoffkerne zu einem Helium-Kern fusioniert. Der Name CNO-Zyklus weist darauf hin, dass dieser Prozess unter der Verwendung von Kohlenstoff (C), Stickstoff (N) und Sauerstoff (O) stattfindet.
Ab einer Masse des 1,4- bis 1,6-fachen unserer Sonne wird über den CNO-Zyklus der größte Teil der Fusion von Wasserstoff zu Helium erfolgen.
Alpha Aa verfügt über die ca. 5,3-fache Masse unserer Sonne.
Alpha1 Aa ist bereits einen Schritt weiter. Am Ende der Kern-Wasserstoff-Fusion ist die Dichte des Sterns so hoch, das dieser entartete. Entartung bedeutet, dass sich die Materie nicht auf herkömmliche Weise beschreiben lässt, da die Dichte so extrem groß ist. Es hat nichts mit dem klassischen idealen Gas zu tun.
Durch die hohe Dichte und Temperatur hat dann bei Alpha Aa das Helium-Brennen begonnen. Das heißt, es werden drei Helium-Kerne im Inneren des Sterns im Rahmen einer Kernfusion in Kohlenstoffe und Sauerstoff umgewandelt. Dabei wird Gammastrahlung ausgesendet.
Diese Kernfusion kann nur bei Temperaturen von über 100 Mio. Kelvin stattfinden. Der Vorgang wird auch als Drei-Alpha-Prozess bezeichnet. Durch den äußerst rasch aufschaukelnden Prozess wird die Temperatur sehr schnell sehr hoch. Die explosionsartige Fusion von Helium im Drei-Alpha-Prozess wird auch Helium-Blitz genannt.
Sobald die Kerntemperatur genügend hoch ist, wird die Entartung wieder aufgehoben. Dadurch, dass das Gas wieder „normal“ wird und der herrschende Gasdruck wieder temperaturabhängig ist, kommt es zu einer heftigen Expansion des Sterns. Der Stern dehnt sich aus und sein Umfang wird größer.
Aufgrund der Ausdehnung besitzt Alpha Aa den ca. 64,6-fachen Radius unserer Sonne.
Die Hülle des Sterns ist aber in der Lage den Ausbruch abzufangen. Es kommt zu keiner Explosion des Sterns. Aber durch die Heftigkeit der Ausdehnung des Sterns werden die äußeren kühleren Schichten abgeworfen. Dadurch gelangen Materie und Gaswolken ins All, die wiederum zum Beginn von neuen Sternen werden können.
Alpha1 Aa besitzt eine visuelle durchschnittliche Helligkeit von ca. 4,27 mag. Je höher der Wert ist, der in Magnituden (mag) gemessen wird, umso schwieriger kann ein Stern von uns gesehen werden. Ab einer Magnitude von mehr als ca. 6,0 ist ein Stern nur noch im Teleskop sichtbar. Die Magnitudenzahl wurde in einem logarithmischen System entwickelt, um die Lichtschwäche eines Sterns darzustellen. Unsere Sonne hat eine visuelle Helligkeit von ca. - 26,7 mag.
Die absolute Helligkeit von Alpha1 Aa dürfte ca. – 1,90 mag betragen. Die absolute Helligkeit wird aus einer Entfernung von 32,6 Lichtjahren gemessen; unsere Sonne hat eine absolute Helligkeit von 4,84 mag. 32,6 Lichtjahren entsprechen 10 Parsec, eine weitere astronomische Entfernungseinheit.
Aufgrund der vergrößerten Oberfläche strahlt Alpha1 Aa mit der ca. 1.800-fache Leuchtkraft unserer Sonne.
Die römische Ziffern Ib teilt Alpha1 Aa Capricorni in die Leuchtkraftklasse der Überriesensterne mit einer etwas schwächerer Leuchtkraft (Ib) ein. Er ist ein Gelber Überriese.
Die Überriesen sind massereiche Sterne der Spektralklasse F und G sowie ehemaligen Hauptreihensterne. Sie sind etwas kühler und besitzen auch weniger Masse als die Blauen Riesen. Die Gelben Riesen befinden sich am Beginn oder in der Mitte ihres Sternenlebens.
Vielfach sind die Gelben Riesen auch ehemaligen Blaue Riesensterne, die kurz davor stehen zu einem Roten Riesen zu werden.
Die Gelben Riesen werden je nach Masse zwischen zehn und hundert Millionen Jahre alt.
Alpha 1 Aa zeigt in seinem Spektrum einen N/C-Wert von mehr als 1,1. Bei einem Stern in seinem Entwicklungsstand dürfte ein so hoher Wert eigentlich nicht vorkommen. Eine Annahme ist, dass Alpha 1 Aa ein der ersten sogenannten „dredge-up-star“ ist.
Dredge-up bedeutet, dass die Konvektionszone vom Kern bis zur Oberfläche verläuft und den gesamten Stern erfasst. Dadurch erscheinen Elemente an der Oberfläche des Sterns, die im Regelfall nur im Kern zu finden sind. Ein Stern mit einer Masse wie Alpha Aa kann in seiner Entwicklung bis zu drei dredge-ups durchlaufen.
Alpha1 Ab weist eine visuelle Helligkeit von ca. 8,6 mag auf. Aufgrund der weiten Entfernung konnten bisher noch keine weiteren Daten ermittelt werden.
Das Doppelsternsystem Alpha1 A entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 7,3 km/s.
Die Sterne Alpha1 B, C und D stehen wahrscheinlich nur visuell in einer Linie mit dem Doppelsternsystem Alpha1 A.
Alpha1 B und Alpha1 D weisen eine visuelle Helligkeit von ca. 14,1 und 14,2 mag auf. Mehr ist über die beiden Sterne nicht bekannt.
Über Alpha1 C sind einige Daten mehr bekannt. Nach den Daten der GAIADR2-Messungen besitzt er den ca. 29,4-fachen Radius und die ca. 247-fache Leuchtkraft unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.222 Kelvin und er ist ca. 3.030 Lichtjahre von uns entfernt. Sein Entwicklungsstand konnte bisher noch nicht ermittelt werden.
1.2 Algedi (α2 - Alpha2 Capricorni, 6 Capricorni, HD 192947)
Algedi ist ein Dreifachsternensystem in ca. 102 Lichtjahren Entfernung.
Der Stern Alpha2 A und das Doppelsternsystem Alpha2 BC weisen eine Umlaufzeit von ca. 1.500 Jahre auf.
Im Doppelsternsystem BC beträgt die Umlaufzeit der beide Sterne Alpha2 B und C etwa 244 Jahren.
Über die Entfernung der einzelnen Sterne zu einander ist nichts bekannt.
Das Dreifachsternensystem Algedi kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 0,47 km/s auf uns zu.
Alpha2 A ist ein Riesenstern der Spektralklasse G9III.
Er befindet sich am Anfang der Kernfusion von Helium zu Kohlenstoffen und Sauerstoff. In seinem Entwicklungsstadium wird er im Hertzsprung-Russell Diagramm auf dem sogenannter „Red Giant Branch“ (RGB-Stern) im „Roten Riesenast“ verortet.
Die RGB-Sterne, die sich in diesem Teil des Diagramms befinden, haben die Kern-Wasserstofffusion bereits beendet und stehen am Anfang der Kern-Heliumfusion.
Alpha 2A besitzt die ca. 2,1-fache Masse und den ca. 10-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.735 Kelvin und er strahlt mit der ca. 45,6-fachen Leuchtkraft unserer Sonne. Er dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 2,7 km/s.
Alpha 2A weist eine visuelle Helligkeit von ca. 0,98 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 3,57 mag auf.
Alpha2 B und C sind wahrscheinlich Rote Zwergsterne.
Rote Zwerge sind die kleinsten Sterne, in deren Kern die Fusion von Wasserstoff zu Helium stattfindet. Rund drei Viertel aller Sterne sind Rote Zwerge. Sie strahlen aber mit so geringer Energie, dass kein einziger von der Erde aus mit bloßem Auge gesehen werden kann.
Alpha2 B und C weisen eine visuelle Helligkeit von ca. 11,2 mag und 11,5 mag auf.
Rote Zwergsterne besitzen eine Masse, die zwischen 7,5% und 60% unserer Sonne liegt. Bei einer geringeren Masse wären die beiden Sterne jeweils ein Brauner Zwerg und es käme keine Kern-Wasserstofffusion zustande.
Die Masse von Alpha2 B und C wird auf jeweils 50% unserer Sonne geschätzt.
Aufgrund der geringen Masse laufen die Fusions-Prozesse bei den Roten Zwergsternen wesentlich langsamer ab. Da die Fusion so langsam abläuft, haben selbst die ältesten Roten Zwerge die Hauptreihen-Phase noch nicht verlassen, auch wenn Sie so alt wie unser Universum wären (ca. 13,7 Mrd. Jahre).
Bei den Roten Zwergen findet keine Energieabgabe durch Strahlung statt. Das gesamte heiße Plasma steigt vom Sterneninneren nach oben, kühlt dort ab und sinkt wieder nach unten.
Aufgrund der Lichtundurchlässigkeit des dichten Sterneninneren erreichen die durch die Kernfusion entstandene Photonen nicht die Oberfläche. Stattdessen wird die gesamte entstandene Energie durch Konvektion vom Kern zur Oberfläche weitergeleitet wird.
Das entstandene Helium befindet sich daher nicht im Kern. Das bedeutet als Folge davon, die Roten Zwerge können mehr Wasserstoff als ein Hauptreihenstern verschmelzen, bevor sie mit der Kern-Heliumfusion beginnen.
Alle diese einzelnen Teile sorgen dafür, daß Rote Zwergsterne mehrere 10 Milliarden bis zu Billionen von Jahren für die Kern-Wasserstofffusion benötigen.
2. Alshat (ν - Nu Capricorni, 8 Capricorni, HD 193432)
Alshat ist ein visuelles Doppelsternsystem.
Alshat ist ein weiß-blau leuchtender Hauptreihenstern der Spektralklasse B9,5V in ca. 253 Lichtjahren Entfernung. Er befindet sich noch mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium.
Sterne der Spektralklasse B sind sehr heiße Sterne, da sie ihren Wasserstoff sehr schnell fusionieren. Sie sind zwar selten, aufgrund ihrer Leuchtkraft werden aber ein Drittel der hellsten Sterne am Nachthimmel der Spektralklasse B zugerechnet.
Den größten Teil ihrer Strahlung senden sie aufgrund ihrer hohen Temperatur im ultravioletten Bereich aus.
Alshat ist ein sehr kühler Stern der Spektralklasse B mit einer Oberflächen-Temperatur von rund 10.300 Kelvin. Er besitzt die ca. 2,37-fache Masse, den ca. 2,8-fachen Radius und die ca. 87-fache Leuchtkraft unserer Sonne.
Die Rotationsgeschwindigkeit von Alshat wurde auf etwa 24 km/s gemessen. Da diese für einen Stern seiner Spektralklasse sehr niedrig ist, wird angenommen, dass wir auf den Pol von Alshat blicken.
Alshat besitzt eine visuelle Helligkeit von ca. 4,76 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,32 mag.
Bei verschiedenen Untersuchungen wurde eine ähnliche Häufigkeit verschiedene Elemente in seiner Atmosphäre gefunden wie bei unserer Sonne.
In einer Sichtlinie von ihm befindet sich Nu B mit einer visuellen Helligkeit von ca. 11,7 mag.
3. Dabih (β- Beta Capricorni, 9 Capricorni, HD 193495 und HD 193452)
Dabih ist ein visuelles Mehrfach-Sternensystem.
Beta1 Capricorni (HD 193495) ist ein Dreifach-Sternensystem, das sich nach den GAIADR-Daten in ca. 555 Lichtjahren Entfernung befindet. Aufgrund der ebenfalls neueren Messungen befindet sich das Doppelsternsystem Beta2 Capricorni (HD 193452) in ca. 450 Lichtjahren Entfernung.
Im Dreifachsternensystem Beta1 sind der Stern Beta1 Aa und das Doppelsternsystem Beta Ab ca. 5 AE von einander entfernt mit einer Umlaufzeit von ca. 3,77 Jahren. Eine Astronomische Einheit (AE) ist die durchschnittliche Entfernung von der Sonne zur Erde. Diese beträgt ca. 149,6 Mio. km.
Das sehr enge Doppelsternsystem Beta Ab besteht aus den Sternen Beta Ab1 und Ab2. Die beiden Sterne sind nur ca. 0,1 AE von einander entfernt mit einer Umlaufzeit von ca. 8,7 Tagen.
Das Dreifachsternensystem kommt einer Radialgeschwindigkeit von ca. 19 km/s auf uns zu.
Das Doppelsternsystem Beta2 besteht aus den beiden Sternen Beta Ba und Beta Bb. Diese sind ca. 30 AE von einander entfernt. Über die Umlaufzeit ist nichts bekannt.
Das Doppelsternsystem kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 17,6 km/s auf uns zu.
Beta1 Aa ist ein gelb-orange leuchtender Roter Riesenstern der Spektralklasse G9II. Er befindet sich wahrscheinlich mitten in der Kernfusion von Helium zu Kohlenstoffen und Sauerstoff.
Beta1 Aa besitzt die ca. 4-fache Masse und den ca. 35-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 5.450 Kelvin und er strahlt mit der etwa 600-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
Beta1 Aa weist eine visuelle Helligkeit von ca. 3,08 mag und eine absolute Helligkeit von ca. – 2,03 mag auf
Beta Ab1 ist vermutlich ein weiß-blau leuchtender Hauptreihenstern der Spektralklasse Bp9SiCaIIK. Er wäre damit ein sogenannter „Bp-Stern“.
Die Bp-Sterne sind chemisch eigenartige Sterne (das "p" steht für peculiar (eigenartig)) der Spektralklasse B.
Sie zeigen im Regelfall eine erhöhte Konzentration verschiedener Metallen wie Strontium, Chrom, Mangan und einiger seltener Erden. Bei Beta Ab1 wurden erhöhte Werte von Silicium und die einfach ionisierte Linie des Kalziums gefunden (Ca II K).
Aufgrund der weiten Entfernung ist es jedoch schwer verlässliche Daten zu erhalten.
Beta Ab1 weist eine visuelle Helligkeit von ca. 7,20 mag auf.
Über Beta Ab2 ist bis auf seine Anwesenheit nichts bekannt.
Beta Ba2 ist ein Riesenstern der Spektralklasse B9,5V. Er ist ein sogenannter „CP-Stern“ der Unterklasse der „HgMn-Sterne“, da in seiner Atmosphäre ein hoher Wert von Hg III (3-fach ionisiertes Quecksilber) gemessen wurde.
CP-Sterne sind Hauptreihensterne, die eine ungewöhnliche Metallhäufigkeit zeigen.
Die HgMn-Sterne zeichnen sich dadurch aus, dass bei ihnen eine ungewöhnliche hohe Menge an schweren Elementen wie Quecksilber (Hg) und Mangan (Mn) gefunden wurde. Im Gegensatz zu den anderen CP-Sternen wurde bei den HgMn-Sternen noch kein oder nur ein sehr schwaches Magnetfeld gefunden.
HgMn-Sterne sind im Regelfall Sterne der Spektralklasse A2 bis B5 und der Leuchtkraftklasse V bis IV. Ihre Temperaturen liegen in einem Bereich zwischen 10.000 und 16.000 Kelvin.
Die Oberflächen-Temperatur von Beta Ba2 beträgt ca. 10.600 Kelvin.
Die chemischen Besonderheiten der Atmosphäre der HgMn-Sterne stehen im Zusammenhang mit der Temperatur und der Gravitationskraft des Sterns.
Bei Temperaturen unter 10.000 Kelvin ist Mangan schwer nachzuweisen. Bei Temperaturen über 16.000 Kelvin dagegen verlässt Mangan den Stern über die erhöhte Strahlung. Bei Temperaturen von mehr als 18.000 Kelvin verhindert der Sternenwind, dass sich Mangan in den oberen Schichten eines Sterns halten kann.
HgMn-Sterne zeigen nur sehr geringfügige Pulsationen.
Nur wenn Sterne ein schwaches Magnetfeld (das meisten nicht entdeckt wird) besitzen ist es möglich, dass die schwereren Elemente als Flecken in erhöhter Konzentration auftreten können.
Beta2 Ba besitzt die ca. 5-fache Masse und die ca. 30-fache Leuchtkraft unserer Sonne. Seine Rotationsgeschwindigkeit beträgt ca. 1,2 km/s. Beta2 Ba weist eine visuelle Helligkeit von ca. 6,16 mag auf.
Beta2 Bb weist eine visuelle Helligkeit von ca. 9,14 mag auf. Er besitzt die ca. 3-fache Masse unserer Sonne.
Die Sterne von Beta C, D und E stehen ebenfalls nur visuell in einer Linie
Beta C (HD 193543) ist ein Hauptreihenstern der Spektralklasse F8V in ca. 417 Lichtjahren Entfernung. Er besitzt den ca. 1,8-fachen Radius und die ca. 4,2–fache Leuchtkraft unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 6.160 Kelvin und er kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 48 km/s auf uns zu.
Über die Sterne Beta D, mit einer visuellen Helligkeit von ca. 13,7 mag, und Beta E, mit einer visuellen Helligkeit von ca. 14,4 mag, ist nichts bekannt.
4. θ Theta Capricorni (HD 200761, 23 Capricorni)
Theta Capricorni ist ein Hauptreihenstern der Spektralklasse A1V in ca. 137 Lichtjahren Entfernung. Er befindet sich noch mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium.
Theta Capricorni besitzt die ca. 2,24-fache Masse und den ca. 2,7-fachen Radius unserer Sonne.
Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 9.164 Kelvin und er strahlt mit der ca. 65-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
Theta Capricorni dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 104 km/s.
Theta weist eine visuelle Helligkeit von ca. 4,07 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,60 mag auf. Er kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 10,9 km/s auf uns zu.
Aufgrund von radialen Geschwindigkeits-Schwankungen wurde vermutet, dass Theta Capricorni auch ein Doppelsternsystem sein könnte. Daher wurde er immer wieder beobachtet. Bisher wurde jedoch noch kein Begleiter gefunden.
5. ι - Iota Capricorni (HD 203387, 32 Capricorni)
Iota Capricorni ist ein gelber Riesenstern der Spektralklasse G8III in ca. 201 Lichtjahren Entfernung. Er befindet sich mitten in der Kernfusion von Helium zu Kohlenstoffen und Sauerstoff.
Iota Capricorni ist ein sogenannter „BY-Draconis-Variable“.
BY-Draconis Variable (BYDV-Sterne) sind Sterne der Spektralklasse G bis M. Sie zeigen Helligkeitsveränderungen bis zu 0,5 mag in einem Zeitraum bis zu rund 120 Tagen. Die Variabilität kommt durch Sternflecken (bei unserer Sonne heißen diese Sonnenflecken) zustande. Die BYDV-Sterne sind nach dem Stern BY Draconis benannt.
Iota Capricorni weist eine visuelle Helligkeit von ca. 4,296 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,18 mag auf.
Die Helligkeitsveränderung durch die Sternflecken sind bei uns aufgrund der Rotation des Sterns zu erkennen. Sie zeigen uns die Aktivität des Sterns an. Dabei kann es sich um Flares (Strahlungsausbrüche) und um Fackeln (heißere Gebiete auf der Sternenoberfläche) handeln.
Iota Capricorni besitzt die ca. 2,9-fache Masse und den ca. 10,67-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 5.200 Kelvin und er strahlt mit der ca. 83-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
Iota Capricorni dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 4,37 km/s mit einer Rotationsdauer von rund 68 Tagen. Sein Alter wird auf etwa 390 Mio. Jahre geschätzt.
Iota Capricorni entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 12,3 km/s von uns.
6. Nashira (γ - Gamma Capricorni, HD 206088, 40 Capricorni)
Nashira ist ein gelb-weiß leuchtender Hauptreihenstern der Spektralklasse A mit der Klassifizierung AmkF0h1F1VmF2 in ca. 117 Lichtjahren Entfernung
Als Hauptreihenstern befindet sich Nashira noch mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium. Er besitzt die ca. 2,3-fache Masse und den ca. 4,65-fachen Radius unserer Sonne.
Nashira ist ein sogenannter „Am-Stern“. Die Am-Sterne sind eine Unterklasse der chemically peculiar stars (chemisch eigentümlich Sterne) (CP-Sterne), des Spektraltyps A, bei denen in der Atmosphäre Metalle (m) wie Zink, Strontium, Zirkonium und Barium in erhöhter Konzentration gemessen wurden. In der Astrophysik werden alle Elemente außer Wasserstoff und Helium als Metalle bezeichnet.
Dagegen zeigen die Am-Sterne einen Mangel von anderen Elementen, wie Calcium und Scandium.
Die lange Bezeichnung des Spektraltyps von Nashira mit kF0h1F1VmF2 zeigt an, dass er ein F0-Stern ist, wenn er durch die Calcium-k-Linie beurteilt wird, ein F1V-Stern ist, wenn er nach seinen Wasserstofflinien beurteilt wird und Nashira ein F2-Stern ist, wenn er durch die Schwermetalllinien beurteilt wird.
Nashira wird als ist ein sogenannter “Alpha2 Canum Venaticorum Variable“ (α2 CVn Variable) einstuft.
α2 CVn Variable sind chemisch andersartige Hauptreihensterne der Spektralklasse B8p bis A7p. Sie besitzen starke Magnetfelder und starke Silizium-, Strontium- oder Chrom-Spektrallinien. Die Helligkeitsveränderungen betragen typischerweise 0,01 bis 0,1 mag in einem Zeitraum von 0,5 bis zu max. 160 Tagen.
Nashira weist eine visuelle Helligkeit von durchschnittlich 3,77 mag auf, die sich um ca. 0,03 mag verändert. Seine absolute Helligkeit beträgt ca. 2,6 mag.
Neben diesen „normalen“ Veränderungen, zeigen sich die α2 CVn Variable auch in der Intensität der Spektrallinien und ihre Magnetfelder als variabel.
Die variablen Spektrallinien werden wahrscheinlich der unterschiedlichen Verteilung der Metalle in der Atmosphäre der α2 CVn Variable zugeschrieben. Dadurch wird die Oberflächen-Helligkeit der Sterne an unterschiedlichen Stellen heller oder dunkler. Die Metalle Si, Mn, Cr, Sr und Eu kommen in sehr viel höherer Konzentration vor, als in anderen Sternen. Durch diese stärkere Intensität verändert sich die Helligkeit und führt zu Helligkeitsschwankungen.
Ein weiteres Merkmal der α2 CVn Variablen sind Veränderungen in ihren Magnetfeldern. Dabei wird bisher angenommen, daß die Variabilität verschiedene Ursachen haben kann.
Zum einen zeigen α2 CVn Variable eine schiefe Rotation des Sterns. Der Grund liegt darin, dass die Achse der Magnetfelder und die Rotationsachse des Sterns nicht übereinstimmen.
Ein weiterer Grund liegt in den Aktivitäten des Sterns. Seine Sonnenflecken, die Protuberanzen und Sonnenkorona folgen dem gleichen Schema wie bei unserer Sonne aber in wesentlich größeren Dimensionen.
7. Deneb Algedi (δ - Delta Capricorni, HD 207098, 49 Capricorni)
Deneb Algedi ist ein Doppelsternsystem in ca. 38,7 Lichtjahren Entfernung. Es handelt sich dabei um ein Doppelsternsystem vom Typ „Algol“.
Algol (Beta Persei) ist der Namensgeber der „Algol-Sterne“. Algol-Sterne sind im Regelfall Doppelsternsysteme, bei denen die beiden Sterne regelmäßig so in einer visuellen Sichtlinie zu uns stehen, dass sich die beiden auf ihrer Umlaufbahn gegenseitig bedecken. Der Vorgang läuft genauso ab wie bei einer Sonnenfinsternis auf der Erde.
Die Dauer der Helligkeitsveränderungen und die regelmäßigen Perioden lassen sich genau berechnen. Beim Doppelsternsystem Algol findet alle 2 Tage, 20 Stunden und 49 Minuten eine Bedeckung statt.
Bei Deneb Algedi findet eine Verdunkelung etwa alle 1,0228 Tage statt.
Die Helligkeitsveränderungen bei den Algol-Sternen kann dabei mehrere Magnituden (mag) betragen.
Wenn der kleinere Sterne Delta B vor Delta A vorbeizieht verändert sich die Helligkeit um ca. 0,24 mag. Sobald Delta A vor Delta B steht beträgt die Helligkeitsveränderung ca. 0,09 mag. Das Doppelsternsystem weist insgesamt eine visuelle Helligkeit von ca. 2,81 mag auf.
Daneben kann es neben der Helligkeitsveränderung durch Bedeckung auch noch zu einer Übertragung von Masse von einem Stern auf den anderen geben, wenn die beiden Sterne sehr nahe bei einander stehen.
Obwohl die beiden Sterne sehr nahe beieinander stehen ist bisher noch nicht geklärt ob es zu einer Massenübertragung kommt.
Delta Aa ist ein weiß-blau leuchtender Riesenstern der Spektralklasse A7mIII mit der weiterführenden Klassifizierung kA5hF0mF2II. Delta Aa ist ein sogenannter Metalllinienstern („m“).
Wie Nashira zeigt er dadurch verschiedene Eigenschaften. Delta A hat einen Spektraltyp von kA5hF0mF2II, was anzeigt, dass er ein A5-Stern ist, wenn er durch die Calcium-k-Linie beurteilt wird, er ist ein F0-Stern, wenn er nach seinen Wasserstofflinien beurteilt wird und Delta Aa ist ein F2-Stern, wenn er durch die Schwermetalllinien beurteilt wird.
Delta Aa besitzt die ca. 2-fache Masse und den ca. 1,91-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 7.300 Kelvin und er strahlt mit der ca. 8,5-fachen Helligkeit unserer Sonne.
Delta Aa dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 105 km/s.
Delta Ab ist ein Stern der Spektralklasse G oder K. Er besitzt ca. 73% der Masse und 90% des Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 4.500 Kelvin.
Da er auch Aktivitäten in seiner Chromosphäre (Gasschicht, die sich über der Oberfläche eines Sterns befindet) zeigt, wird angenommen, daß darauf ein Teil der Helligkeitsveränderungen von Delta Ab darauf zurückzuführen ist.
Die beiden Sterne Delta B, mit einer visuellen Helligkeit von ca. 15,00 mag, und Delta C, mit einer visuellen Helligkeit von ca. 13,8 mag stehen in einer Sichtlinie mit Delta A, sie sind jedoch nicht physikalisch mit einander verbunden.
8. κ – Kappa Capricorni (HD 206453, 43 Capricorni)
Kappa Capricorni ist gelb leuchtender Riesenstern der Spektralklasse G8III in ca. 300 Lichtjahren Entfernung. Er befindet sich mitten in der Kernfusion von Helium zu Kohlenstoffen und Sauerstoff.
Kappa Capricorni ist ein sogenannter „Red Clump Star“. Red Clump Stars (Roten Klumpensterne) haben ihren Namen durch die Lage im Hertzsprung-Russel-Diagramm. Sie sind dort eine Ansammlung von Roten Riesen mit einer Temperatur im Bereich von rund 5.000 Kelvin und einer absoluten Helligkeit im Bereich von 0,5 mag (etwas mehr oder weniger). Sie treten an einer Stelle im Diagramm vermehrt auf und bilden dort einen „Klumpen“. Vielfach treten sie in Kugelsternhaufen mittleren Alters auf.
Kappa Capricorni weist eine visuelle Helligkeit von ca. 4,73 mag und eine absolute Helligkeit von ca. - 0,023 mag auf.
Die Red Clump Stars sind ehemalige Hauptreihensterne, die die Kern-WasserstofffFusion im Kern vor langer Zeit beendet haben und mittlerweile Helium im Kern fusionieren.
Kappa Capricorni besitzt die ca. 2,5-fache Masse und den ca. 14-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 5.025 Kelvin und er strahlt mit der ca. 118-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
Die bisher gemessene Rotationsgeschwindigkeit ist sehr gering. Kappa Capricorni kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 2,87 km/s auf uns zu. Sein Alter wird auf etwa 1,2 Mrd. Jahre geschätzt.
9. Kastra (ε - Epsilon Capricorni, HD 205637, 39 Capricorni)
Kastra ist ein Doppelsternsystem in ca. 1.060 Lichtjahren Entfernung
Epsilon Aa und Epsilon Ab sind dabei ca. 1,5 AE von einander entfernt mit einer Umlaufzeit von ca. 129 Tagen. Das Doppelsternsystem weist eine visuelle Helligkeit von ca. 4,62 mag und eine absolute Helligkeit von ca. – 3,03 mag auf.
Die beiden Sterne Epsilon B und C stehen nur visuelle in einer Linie zu dem Doppelsternsystem.
Epsilon Aa ist ein Hauptreihenstern der Spektralklasse B2,5Vpe. Er ist ein sogenannter „Be-Stern“.
Be-Sterne sind im Regelfall Sterne der Spektralklasse B, in deren Spektrum Emissionen (e) der sogenannten „Balmer-Emissionslinien“ gemessen wurde. Die Balmer-Emissionslinien sind eine bestimmte Folge von Spektrallinien des Wasserstoffs (H) im sichtbaren elektromagnetischen Spektrum. Die Emissionslinie mit der größten Wellenlänge wird als Hα (H Alpha) bezeichnet. Hβ, Hγ und Hδ sind dann jeweils mit einer kleineren Wellenlänge sichtbar.
Die Emissionslinien zeigen an, daß die Be-Sterne von einer Scheibe oder Hülle aus Staub und Material umgeben sind. Das Material stammt vom Stern selbst, dass dieser durch seine schnelle Rotation an die Umgebung abgibt.
Epsilon Aa ist ein sogenannter „Shell-Star“ und von einer Hülle umgeben. In der spektroskopischen Ansicht zeigt der Stern verschiedene Absorptions- und Emissionslinien. Der Buchstaben „p“ zeigt diese besondere Intensität der Linien an.
Epsilon Aa ist ein Be-Stern der Unterklasse der „Gamma Cassiopeiae Variabel“ (Gamma Cass Sterne). Sie sind benannt nach dem Prototyp Gamma Cassiopeiae. Dabei handelt sich um eine Unterklasse der sogenannten „Eruptiver Veränderlicher“.
Bei den Eruptiv Veränderlichen Sternen ändert sich die Helligkeit nicht in einer bestimmten Periode sondern unvermittelt (abrupt).
Epsilon Aa zeigt eine durchschnittliche visuelle Helligkeitsveränderung von rund 0,16 mag.
Die Helligkeitsveränderungen bei den Eruptiv Veränderlichen können verschiedene Gründen haben.
Die Gamma-Cas-Sterne sind sehr schnell rotierende Riesensterne. Sie zeigen dabei einen Materialabfluss durch Eruptionen, vergleichbar mit einem Vulkanausbruch bei uns auf der Erde. Dieses Material bildet um den Stern einen zirkumstellaren Ring aus Gas und Materie in Äquatornähe.
Die Rotationsgeschwindigkeit von Epsilon Aa beträgt ca. 225 km/s. Daher weist er eine Form auf, die eher einem Ei gleicht. Sein Äquator-Radius ist um etwa 7% größer als der Polradius.
Gleichzeitig wird aus dem Ring wieder Material auf den Stern zurückgeführt. Es findet also eine Absorption (Aufnahme) und Reemission (Abgabe) von ausgestoßener Materie statt, was es schwierig macht die einzelnen Wellenlängen des Sterns zu bestimmen.
Epsilon Aa besitzt die ca. 8,6-fache Masse und den ca. 6,4-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 18.000 Kelvin und er strahlt mit der ca. 4.650-fachen Leuchtkraft unserer Sonne. Seine visuelle Helligkeit beträgt ca. 5,0 mag.
Epsilon Ab besitzt die ca. 5,8-fache Masse und den ca. 4,1-fachen Radius unserer Sonne. Seine visuelle Helligkeit beträgt ca. 6,2 mag und er strahlt mit der ca. 1.200-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
Epsilon B weist eine visuelle Helligkeit von ca. 10,11 mag und Epsilon C eine visuelle Helligkeit von ca. 14,1 mag auf. Mehr ist über sie nicht bekannt.
10. 36 Capricorni (HD 204381, HR 8213)
HD 204381 ist ein Riesenstern der Spektralklasse G5III in ca. 179 Lichtjahren Entfernung.
HD 204381 befindet sich mitten in der Kernfusion von Helium zu Kohlenstoffen und Sauerstoff. Er ist wie Kappa Capricorni ein sogenannter „Red Clump Star“. Sein Alter wird auf etwa 2,42 Mrd. Jahre geschätzt.
HD 204381 besitzt die ca. 1,94-fache Masse und den ca. 8,23-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 5.320 Kelvin und er strahlt mit der ca. 49-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
HD 204381 weist eine visuelle Helligkeit von ca. 4,5 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 0,81 mag auf. Er kommt mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 21 km/s auf uns zu.
HD 204381 ist ein sogenannter „High Proper Motion Star“. Diese Sterne zeigen im Vergleich zu anderen Sternen in ihrer unmittelbaren visuellen Nähe eine größere Bewegung am Nachthimmel. Der Stern mit der größten Eigenbewegung ist Barnards Pfeilstern mit einer Bewegung von 10,4 Bogensekunden pro Jahr. Seine Geschwindigkeit wird auf etwa 140 km/s geschätzt.
11. ζ - Zeta Capricorni (34 Capricorni, HD 204075)
Zeta Capricorni ist ein Doppelsternsystem in ca. 177 Lichtjahren Entfernung.
Zeta A und Zeta B sind ca. 6 AE von einander entfernt mit einer Umlaufzeit von ca. 6,5 Jahren. Das Doppelsternsystem entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 2,1 km/s.
Zeta Capricorni ist ein sogenannter „Bariumstern“.
Barium-Sterne werden im Regelfall der Leuchtkraftklasse der Riesensterne und den Spektralklassen G bis K zu geordnet. Alle Barium-Sterne kommen in sehr engen Doppelsternsystemen vor, bei denen ein Transfer von Masse stattfindet (wechselwirkendes Doppelsternsystem). Wir sehen heute nur noch das Ergebnis.
Vor langer Zeit wurde auf den jetzigen Riesen-Barium-Stern Masse seines Partners übertragen, als sich der Barium-Stern noch in der Entwicklungsphase eines Hauptreihensterns befand.
Der heute kleinere Stern, Zeta B, war der Spenderstern. Zu diesem Zeitpunkt war Zeta B ein Kohlenstoffstern, der im Hertzsprung-Russel-Diagramm (HRD) dem asymptotischen Riesenast (AGB: Asymptotic Giant Branch) zuzuordnen wäre.
In diesem Teil des HRD befinden sich die kühlen Riesensterne, die am Ende ihres Sternenlebens angelangt sind.
Bei diesen Riesensternen läuft im Regelfall auch der sogenannte „s-Prozess“ (s = slow, langsam) ab. Dieser findet bei einer niedrigen Neutronendichte und relativ niedrigen Temperaturen des Sterns statt. Sterne, die sich in diesem Stadium befinden, fusionieren alle uns bekannten Elemente bis zu einer Massenzahl von A = 210.
Der s-Prozess läuft hauptsächlich in Sternen ab, in deren Kern das Wasserstoff- und Helium-Brennen bereits zum Erliegen gekommen ist und in denen durch Schalenbrennen in einer Schale um den Kern Helium zu Kohlenstoff fusioniert wird.
Barium-Sterne zeigen nun bei Messungen in ihrer Atmosphäre einen höheren Anteil an diesen „s-Prozess-Elementen“ sowie auch von Barium. Dabei handelt es sich um einfach ionisiertes Barium (Ba II), dass bei einer Wellenlänge von λ = 455,4 nm gefunden wird.
Diese Fusionsprodukte gelangten dann bei Zeta B im Rahmen der Konvektion in die oberen Bereiche der Atmosphäre. Konvektion bedeutet, dass im Rahmen von Austausch und Vermischung der einzelnen Schichten im Stern die s-Prozess-Elemente langsam vom Inneren des Sterns nach außen zur Oberfläche vordringen.
Wie dann die Elemente und ein Großteil der Masse von Zeta B auf Zeta A erfolgte, ist noch nicht ganz geklärt, da dieser Übertragungsprozess bei den Barium-Sternen noch nicht vollständig analysiert ist.
Am Ende des Prozesses hat sich dann Zeta B von einem Riesenstern zu einem Weißen Zwerg entwickelt.
Die beiden Sterne stehen so nah beieinander, dass sie sich an der sogenannten „Roche-Grenze“ befinden (benannt nach Edouard Albert Roche). Bis zur Roche-Grenze hat ein Stern, der einen anderen Stern umkreist, eine innere Stabilität, die den Stern zusammenhält. Je näher sich zwei Sterne an dieser Grenze aufhalten, umso größer ist ihre gegenseitige Beeinflussung. Das kann bis dazu führen, dass der kleinere Himmelskörper verformt oder sogar zerstört wird.
Bei uns ist das Doppelsternsystem in einen Zeitpunkt zu sehen, bei dem der Spenderstern (Zeta B) schon lange ein Weißer Zwerg ist und der Barium-Stern (Zeta A) sich zu einem Roten Riesen entwickelt hat.
Zeta A ist ein milder Bariumstern der Spektralklasse G8IIIp (das "p" steht für peculiar (eigenartig) und zeigt eine erhöhte Konzentration verschiedenen Metalle an, meist Seltene Erden).
In der Atmosphäre von Zeta A wurde u a. Zirkonium und andere Seltene Erden in zum Teil 10-fach höherer Konzentration als bei unserer Sonne nachgewiesen.
Zeta A besitzt die ca. 4-fache Masse und den ca. 29-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 5.397 Kelvin und er strahlt aufgrund der vergrößerten Oberfläche mit der ca. 490-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
Zeta B ist ein Weißer Zwerg der Spektralklasse DA2.2. Damit ist er ein Stern der entweder eine wasserstoffreiche Atmosphäre besitzt oder dessen äußere Schicht sehr starke Wasserstoff-Spektrallinien zeigt.
Ein Weißer Zwerg ist ein Stern, bei dem keine Kernfusion mehr stattfindet. Er ist das Endstadium eines Sterns, der eine zu geringe Masse besaß, um als Supernova-Ausbruch zu einem Neutronenstern oder zu einem Schwarzen Loch zu enden.
Weiße Zwerge befanden sich am Ende ihres Sternenlebens unterhalb der sogenannten Chandrasekhar-Grenze (benannt nach dem indischen Subrahmanyan Chandrasekhar) mit einer Restmasse von weniger als 1,44 Sonnenmassen.
Im Regelfall bestehen Weiße Zwerge aus einem Kern aus heißer entarteter Materie von extrem hoher Dichte. Diese wird von ei-ner dünnen, leuchtenden Photosphäre umhüllt.
Ein Weißer Zwerg, der die Masse unserer Sonne besitzt, weist nur die Größe des ein bis zweifachen unserer Erde. Sie können eine Oberflächen-Temperatur von mehr als 50.000 Kelvin besit-zen. Aufgrund ihrer geringen Größe sind sie jedoch sehr leuchtschwach.
Die Oberflächen-Temperatur von Zeta B beträgt ca. 23.000 Kelvin. Seine visuelle Helligkeit beträgt ca. 12,5 mag und er besitzt etwa eine Sonnenmasse.
12. A Capricorni (HD 200914, 24 Capriconi)
A Capricorni ist ein Roter Riesenstern der Spektralklasse M1 in ca. 382 Lichtjahren Entfernung.
A Capricorni hat bereits die Kernhelium-Fuison beendet. Er ist ein sogenannter AGB-Stern (Asymptotic Giant Branch).
Ein AGB-Stern ist benannt nach seiner Lage im Hertzsprung-Russel-Diagramm (HRD-Diagramm). Dort gibt es eine Region, in der die Riesensterne vom Hauptstrahl, wie ein Ast (branch) bei einem Baum, abzweigen. Im HRD-Diagramm sind dort die kühleren Riesensterne beheimatet. Nach der gängigen Theorie befinden sich alle Sterne, die eine Masse im Bereich von 0,6 bis 10 Sonnenmassen besitzen einmal in ihrem Sternenleben im AGB-Zweig.
Im Zentrum von A Capricorni befindet sich ein entarteter, verdichteter Kern aus Kohlenstoff und Sauerstoff, das heißt die Masse im Kern ist so dicht, dass sich der Zustand nicht auf herkömmliche Weise beschreiben lässt.
Der Kern ist von einer helium-brennenden Schale umgeben, der sich an die äußere wasserstoff-brennenden Schale anschließt.
Daran schließt sich dann eine sehr große Hülle mit Wasserstoff an. Diese Hülle wird vom Sterneninneren durch Konvektion (Austausch und Vermischung der einzelnen Schichten) durchgemischt.
Durch die regelmäßige Durchmischung der einzelnen Regionen kommt es zu kernphysikalischen Prozessen, in denen ein Großteil aller bekannten Elemente entstehen. Diese Elemente werden im Rahmen der Konvektion an die Oberfläche des Sterns getragen.
Dort kühlt sich dann das Gas ab und aus den Elementen werden Moleküle. Dieses molekulare Gas kühlt sich dann weiter ab und wird dann zu kleinsten Staubteilchen. Diese nehmen das abgebende Licht des Sterns auf und werden dann durch den Sternenwind weggeblasen (Absorption des emittierenden Lichts des Sterns).
Durch die Ausdehnung haben die äußeren Gasschichten nur eine sehr geringe Dichte. Damit sind die Gasschichten nur noch durch eine schwache Gravitation an den Stern gebunden. Durch Sternenwinde werden die äußeren Gasschichten abgestoßen und bilden für einige Zeit einen planetarischen Nebel um den Stern.
A Capricorni besitzt den ca. 54-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 3.900 Kelvin und er strahlt aufgrund der vergrößerten Oberfläche mit der ca. 611-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
A Capricorni weist eine visuelle Helligkeit von ca. 4,49 mag und eine absolute Helligkeit - 1,24 mag auf. Er entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 32 km/s von uns und wird wie HD 204381 aufgrund seiner hohen Eigenbewegung als ein „High Proper Motion Star“ eingestuft.
13. ω Omega Capricorni
Omega Capricorni ist ein Roter Riesenstern der Spektralklasse M0IIIBa0.5 in etwa 1.000 Lichtjahren Entfernung.
Wie Zeta Capricorni ist Omega ein Bariumstern. Er befindet sich noch mitten in der Helium-Kernfusion zu Kohlenstoffen und Sauerstoff. Bariumsterne sind im Regelfall enge Doppelsternsysteme. Aufgrund der weiten Entfernung wurde sein Begleiter bisher noch nicht gefunden.
Omega Capricorni besitzt den ca. 172-fache Radius und die ca. 6,8-fache Masse unserer Sonne. Die Entfernung von Sonne zur Erde beträgt ca. 215 Sonnenradien.
Seine Oberflächen-Temperatur beträgt ca. 3.915 Kelvin und er strahlt aufgrund der vergrößerten Oberfläche mit der ca. 6.270-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
Er dreht sich mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 4,68 km/s.
Omega Capricorni weist eine visuelle Helligkeit von ca. 4,11 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 2,7 mag auf. Er entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 9,1 km/s.
Omega Capricorni ist vermutlich ein Mitglied der „Ursa Major Moving Group“ (Colliander 25, Colli 25). Ein Bewegungshaufen (Moving Group) ist eine Ansammlung von Sternen, die die gleiche Eigenbewegung besitzt. Die Sterne waren einst gemeinsam in einen offenen Sternhaufen zusammen und haben sich mit der Zeit von einander wegbewegt.
Aufgrund der Eigenbewegung von 25,7 km/s könnte er auch ein sogenannter „Runaway Star“ sein. Er bewegt sich mit einer höheren Geschwindigkeit durch das interstellare Medium als unserer Sonne (ca. 20 km/s).
Durch die hohe Geschwindigkeit kann von einem Runaway Star auf seinen Herkunftsort geschlossen werden.
14. ψ Psi Capricorni (16 Capricorni, HD 197692)
Psi Capricorni ist ein Hauptreihenstern der Spektralklasse F5V in ca. 47,9 Lichtjahren Entfernung. Er befindet sich mitten in der Kernfusion von Wasserstoff zu Helium.
Psi Capricorni besitzt die ca. 1,37-fache Masse und den ca. 1,51-fachen Radius unserer Sonne. Seine Oberflächentemperatur beträgt ca. 6.570 Kelvin und er strahlt mit der ca. 3,8-fachen Leuchtkraft unserer Sonne.
Aufgrund der relativen Nähe zu uns konnte bei Psi Capricorni die differentielle Rotation beobachtet.
Differentiellen Rotation bedeutet, dass die Drehgeschwindigkeit eines Sterns nicht überall gleichgroß ist. Meistens haben die Pole eine niedrigere Rotationsgeschwindigkeit als die Äquatorregion.
Der Grund dafür ist, dass die Sterne keine festen Himmelskörper wie unsere Erde sind, sondern vor allem aus Gas bestehen. Die differentielle Rotation wird wahrscheinlich durch Gasströmungen in der Konvektionszone des Sterns verursacht. Diese sorgen dafür, dass sich der Sternenäquators sich noch schneller dreht als der Pol.
Bei unserer Sonne beträgt die Rotationsdauer am Äquator rund 25 Tage und in Polnähe bis zu 37 Tage.
Die differentielle Rotation ist ein zentraler Bestandteil des magnetischen Dynamos in den Sternen. Dieser ist für die meisten von uns beobachteten Aktivitäten eines Sterns verantwortlich.
Psi Capricorni dreht sich am Äquator mit einer Rotationsgeschwindigkeit von ca. 42 km/s. Am Pol ist diese um etwa 6 km/s höher.
In einer Entfernung von etwa 38,75 AE wird Psi Capricorni von einer Trümmerscheide mit einer Temperatur von 60 Kelvin umrundet.
Diese Trümmerscheiben bestehen aus Staub, Gasen und größeren Brocken, den Planetesimalen (Planetensimale stehen am Beginn der Planetenbildung).
Psi Capricorni weist eine visuelle Helligkeit von ca. 4,13 mag und eine absolute Helligkeit von ca. 3,33 mag auf. Er entfernt sich mit einer Radialgeschwindigkeit von ca. 20,3 km/s von uns. Vor rund 467.000 Jahren war Psi Capricorni etwa 20 Lichtjahre von uns entfernt.